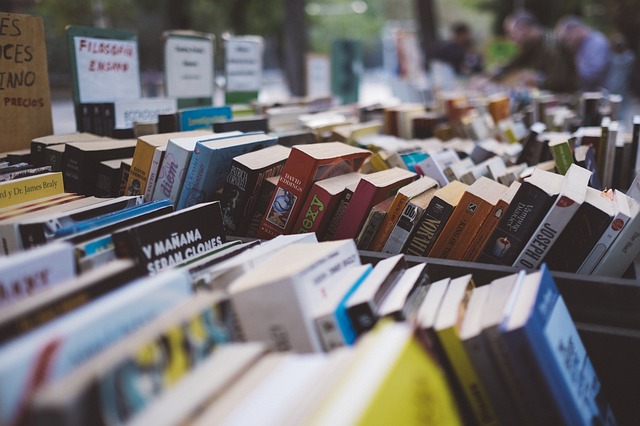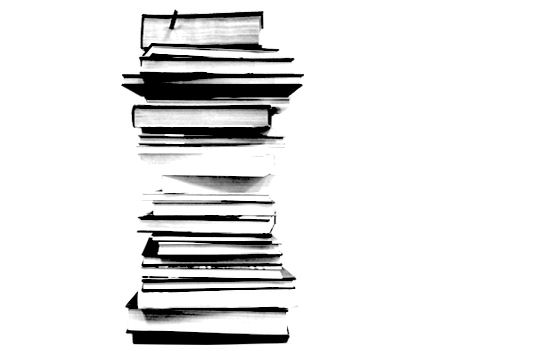Archiv
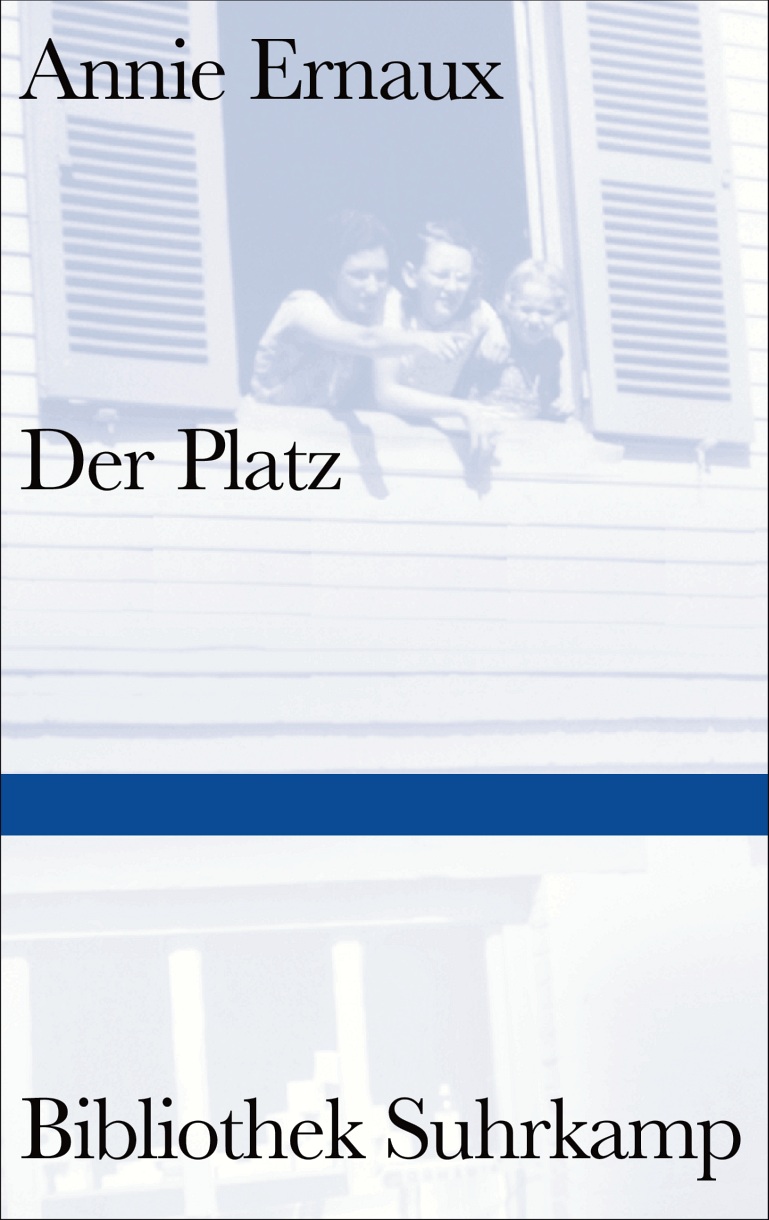
ANNIE ERNAUX. DER PLATZ
Aus dem Französischen von Sonja Finck
Suhrkamp VerlagDie französische Autorin Annie Ernaux veröffentlichte 1983 in ihrer französischen Heimat einen sehr schmalen Text: "La Place", "Der Platz", erscheint nun endlich erstmals auf Deutsch. Auf nicht einmal einhundert Seiten lesen wir eine atemberaubend analytische Erkundung einer Herkunft, die zu einer Selbstbefragung und Milieuerzählung wird und mich an Albert Camus’ "Der erste Mensch" erinnert hat. In der nordfranzösischen Provinz aufgewachsen, schildert Annie Ernaux, woher sie kommt: Das Leben der Großeltern und Eltern ist der Notwendigkeit geschuldet zu arbeiten, um zu überleben, Bücher gibt es keine in dieser Welt, vielleicht die Bibel. Annie darf zur Schule, sie darf lernen, auch über das übliche Maß hinaus, und alles "Nahe wird ihr fremd". "Vor den Verwandten und Kunden Verlegenheit, fast Scham, weil ich mit siebzehn noch kein eigenes Geld verdiente …" Schuldgefühle begleiten diesen Aufbruch, diese Reise zu sich selbst. Das Schreiben, woher man kommt, ist zwingend. "Ich werde die Worte, Gesten, Vorlieben meines Vaters zusammentragen, das, was sein Leben geprägt hat, die objektiven Beweise einer Existenz, von der auch ich ein Teil gewesen bin. Der sachliche Ton fällt mir leicht …" Weltliteratur! Silke Grundmann
94 Seiten
18€
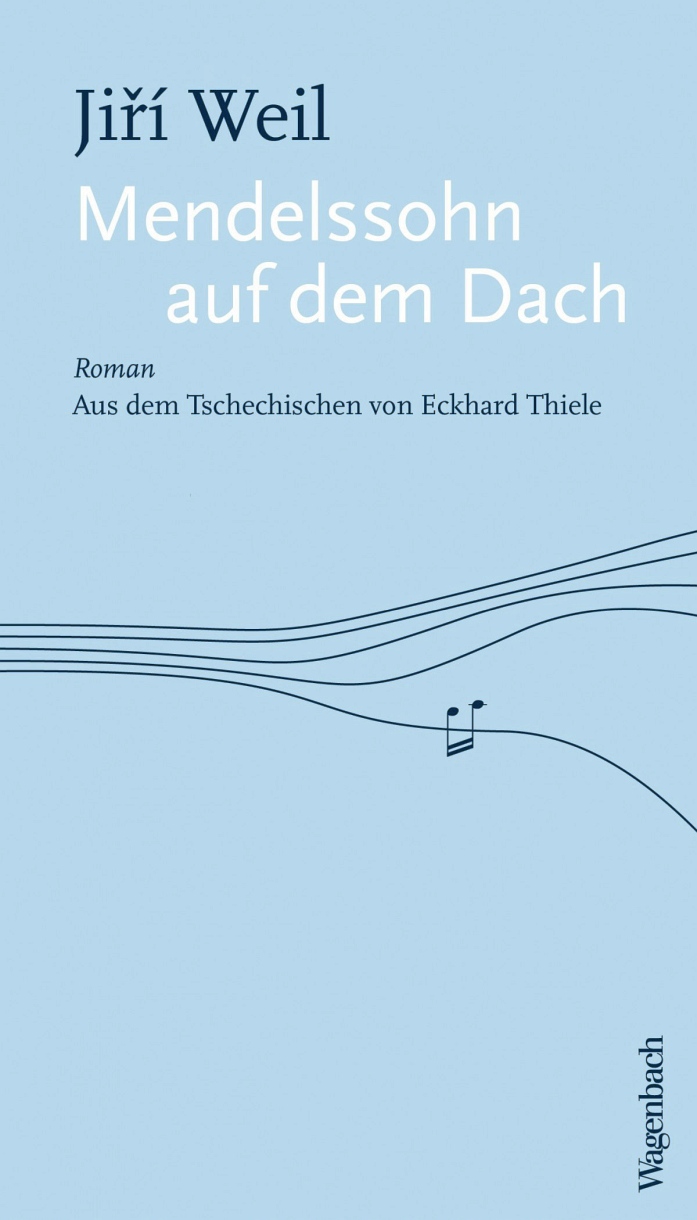
JIŘÍ WEIL. MENDELSSOHN AUF DEM DACH
Wagenbach Verlag
In der Philharmonie des besetzten Prags hört Reinhard Heydrich, stellvertretender Reichsprotektor und kenntnisreicher Musikliebhaber, Mozart. Nach dem Konzert, auf sein Auto wartend, entdeckt er auf dem Sims des Konzerthauses die Statue des Komponisten Mendelssohn. Wütend über diesen Hohn befiehlt er deren sofortigen Abriss. Die damit beauftragten Arbeiter jedoch wissen nicht, welche der Figuren Mendelssohn sein könnte, einer meint »na der mit der längsten Nase« – das aber ist Richard Wagner. In absurden Bemühungen wird der Komponist identifiziert. Die Arbeiter zertrümmern die Statue nicht, sondern legen sie sorgsam aufs Dach, von unten nicht mehr sichtbar – wer weiß?
Mit dieser Groteske beginnt der Roman. Es ist die Zeit der beschleunigten Deportationen nach Osten, der Einrichtung der Festung Theresienstadt als Konzentrationslager, aber auch der Beginn des Widerstands, der zum Attentat und Tod Heydrichs führt. Jirí Weil, der in Prag illegal überlebt hat, beschreibt leise, nicht dramatisierend, die immer bedrohlicher werdende Situation der Menschen, die perfekte Organisation der Unterdrückung, die Solidarität Einzelner mit den Verfolgten, aber auch die kleine Freude einer Flussfahrt auf der Moldau. Ein erschütterndes Kapitel erzählt vom Alltag in Theresienstadt und wie durch den Wunsch der SS nach immer schnelleren Deportationen Bahnschienen in die Stadt verlegt werden. Mit den Eisenbahnern dringen Nachrichten und Hoffnung ein. Der Roman endet mit dem Tod zweier kleiner jüdischer, von der Gestapo aufgegriffener Mädchen, die auf die Frage, wer sie versteckt habe, immer nur antworten „wir waren im Wald“ – Bäume, Wald – für Jiří Weil Symbole von Leben und Hoffnung in einer versteinerten Welt. Renate Georgi
283 Seiten
22€
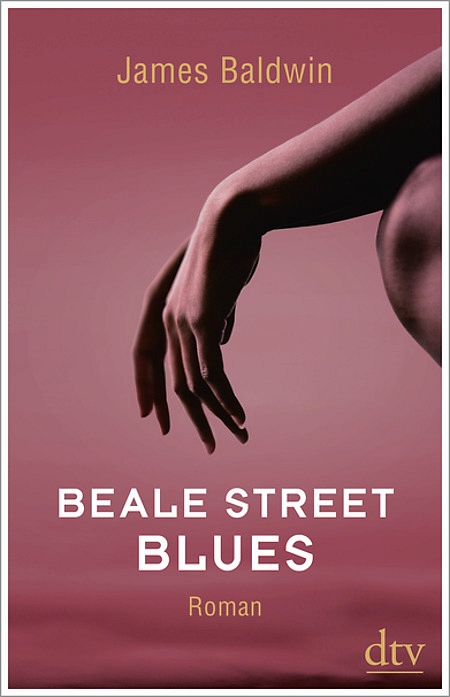
JAMES BALDWIN. BEALE STREET BLUES
Die Lektüre dieses Buches hinterlässt etwas, was nur wirklich ganz große Literatur kann: Staunen, Erfüllung, das Gefühl der Teilhabe von etwas ganz Wichtigem für einen selbst, für das Verstehen von Welt. James Baldwin hat mit Beale Street Blues einen Liebesroman geschrieben, der so traurig ist und gleichzeitig so hoffen lässt, dass man ihn erschüttert und glücklich zuklappt und zum nächsten Baldwin greift. Endlich werden seine wichtigsten Bücher im Verlag DTV neu übersetzt und wieder in einem wunderbaren Deutsch lesbar.
Die Musik dieser Sprache ist eine Mischung aus Bibel, Slang und Blues. Wuchtig, direkt und schmerzhaft schön. Auf Grund einer falschen Aussage eines weißen Polizisten wird Fonny, ein junger Schwarzer, Künstler und großer Liebender, ins Gefängnis gebracht. Er soll eine junge Puerto Ricanerin vergewaltigt haben: Daran ist selbstredend nichts wahr. Die Festnahme ist schlichtweg ein Akt von Rassismus, Sadismus und Erniedrigung - strukturelle Gewalt. Fonnys Freundin Tish, deren Familie und Fonnys Vater setzen alles daran, ihn rauszuholen - doch das ist schwer. Dieser Roman ist auch ein Buch über Solidarität, Einsatz für den anderen. Die Liebe in diesem Buch hat etwas Revolutionäres - sie bewegt etwas, was über zwei Menschen hinausgeht. Ein Buch, bei aller Schwere, das Hoffnung und Optimismus hinausschreit. "Viele von unseren Lieben, viele von unseren Männern sind im Gefängnis gestorben, ja: aber nicht alle."
Nichts in diesem Roman hat Patina angesetzt, er ist thematisch und politisch so aktuell wie in den 50ern, den 70ern und auch noch (leider) heute. Dabei macht es sich James Baldwin mit der Analyse von Rassismus nicht leicht, was ihm auch damals schon, bei Erscheinen des Romans, Kritik eingebracht hat, war doch sein Standpunkt, dass es immer zwei sind, die es zur Unterdrückung eines Menschen braucht: der Andere und man selbst. „Fonny jedenfalls ist aus dieser Falle des Selbsthasses ausgebrochen: Er hat nämlich sich selbst gefunden, so richtig, innen drin: und das hat man gemerkt. Er ist niemandes Nigger. Und das ist ein Verbrechen in diesem beschissen freien Land.“ Lesen Sie dieses Buch! Es wird Sie begeistern! Und ich warte ungeduldig auf den nächsten Band im DTV Verlag. Silke Grundmann
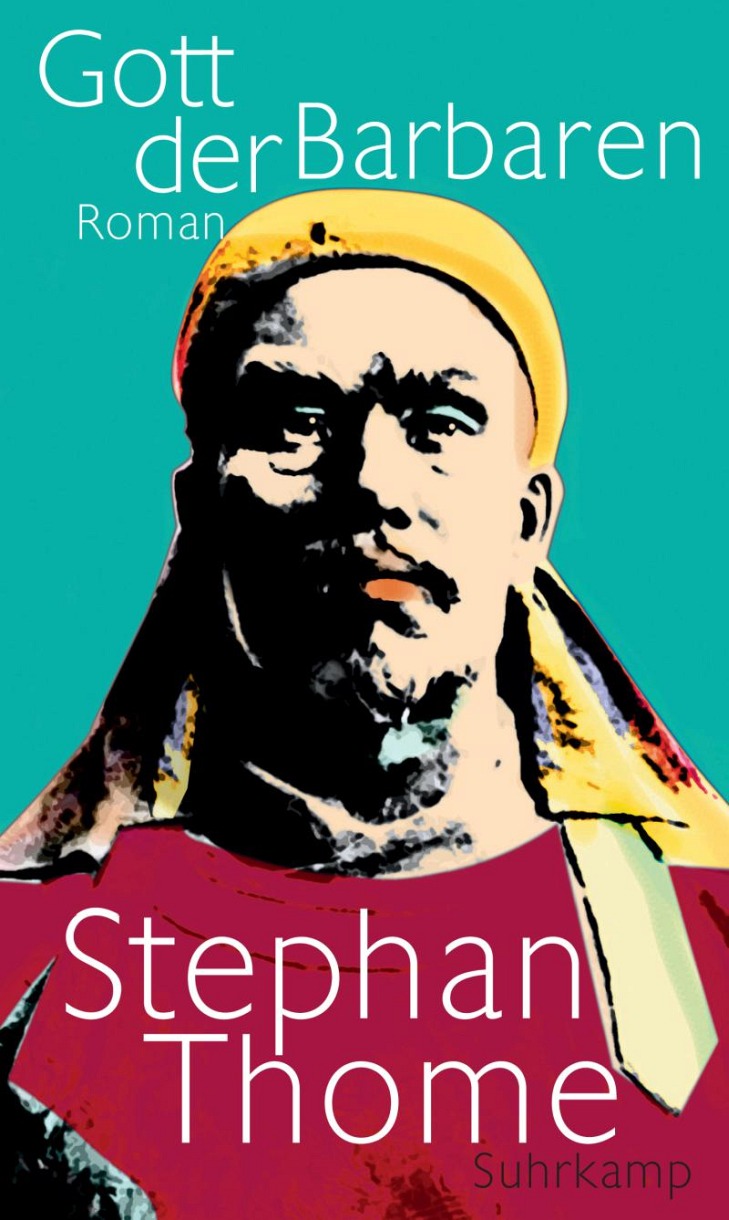
STEPHAN THOME. GOTT DER BARBAREN
Neukamp, fasziniert von der Person und den Gedanken dieses Mannes, reist nach Nanking, mitten in die militärische Auseinandersetzung zwischen diesem zweiten Messias und seinem Gegenspieler, einem eher der Philosophie und einem reformistischen Konfuzianismus zugeneigten mächtigen General des Mandschureichs. Auch die Engländer mischen mit ihren Kriegsschiffen und Kanonen heftig mit. Neukamp kann sich am Ende retten, körperlich verletzt und in seinem idealistischen Weltbild ebenso beschädigt wie eine andere zentrale Figur des Romans, der britische Sonderbotschafter, der die Öffnung Chinas und seiner Häfen für England erreichen soll und mehr und mehr das Fatale seiner Mission erkennt.
Stephan Thomes Roman ist spannend, mit faszinierenden Personen und einem weiten Blick in die Geschiche und Gedankenwelt Chinas. Renate Georgi
25€
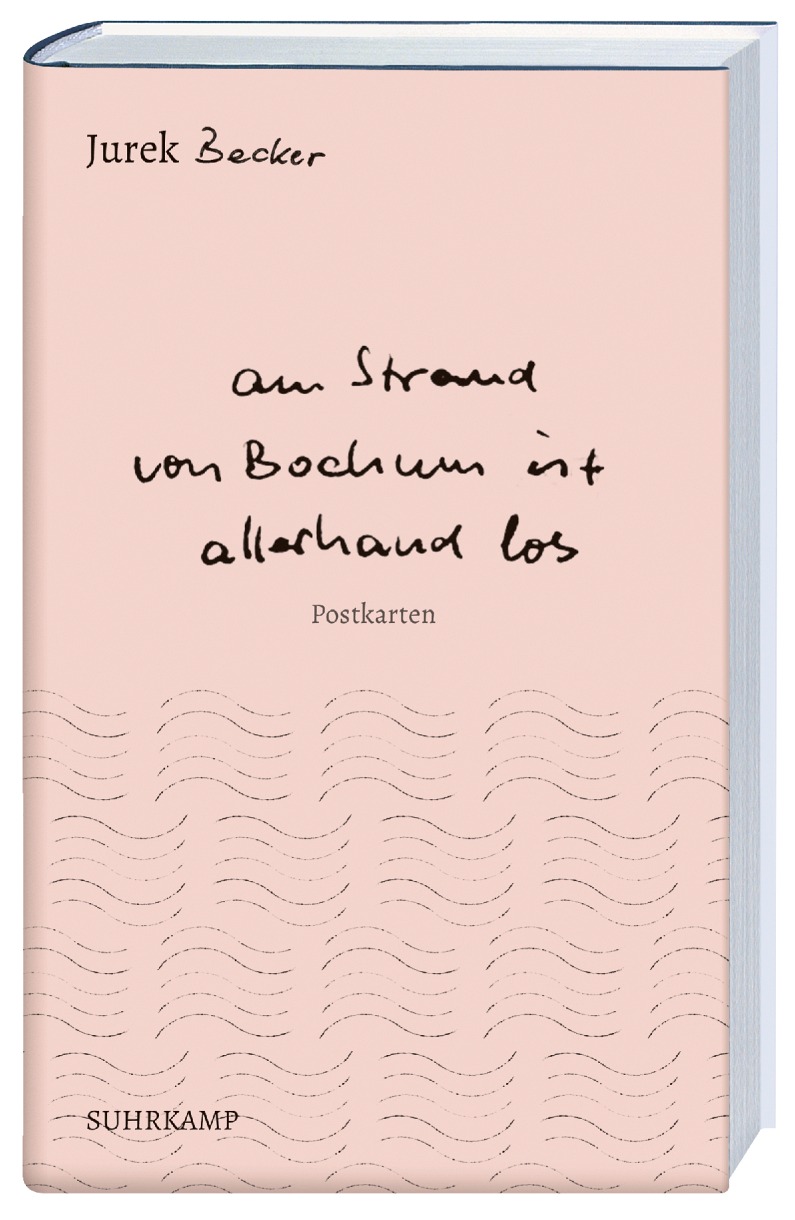
JUREK BECKER. AM STRAND VON BOCHUM IST ALLERHAND LOS
"Du alte Hemmschwelle, Du olle Kuchengabel, Du heller Wahnsinn, Du alte Salatschleuder, Du altes Zinsgefälle, Du süße Blutwurst, Du griffige Formel, Du flammendes Inferno, Du lieber Kullerpfirsich, Du olles Vorderrad, Du billige Ausrede, Du altes Schweigegelübde, Du alter Ziegenkäse, Du schneller Brüter, Du kühne Tat, Du letzter Heuler, Du glückliche Fügung, Du alte Vorzugsaktie, Du verwinkeltes Viertel, Du heilloses Durcheinander, Du tiefer Einblick, Du unbedingter Gehorsam, Du geballte Ladung, Du alte Biokarotte..."
Jurek Becker, der Autor von Jakob der Lügner, war ein leidenschaftlicher Postkartenschreiber: Mit seinem unglaublich schrägen Humor, seiner liebevoll zärtlich, melancholischen Sicht auf das Leben, seiner grenzenlosen Lebensfreude und seinem warmen, empathisch lakonischen Ton schrieb er von unterwegs Postkarten, bildmotivisch sorgfältig ausgesucht, an Skurrilität kaum zu überbieten und von langer Hand geplant. Etwa 400 davon sind in dies em Band versammelt, der den köstlichen Titel: Am Strand von Bochum ist allerhand los trägt. Ein großer Spaß! Eine große Liebeserklärung! Ein kostbares Buch! Du olles Email-Postfach, schreib doch mal wieder eine Postkarte! Silke Grundmann
32€
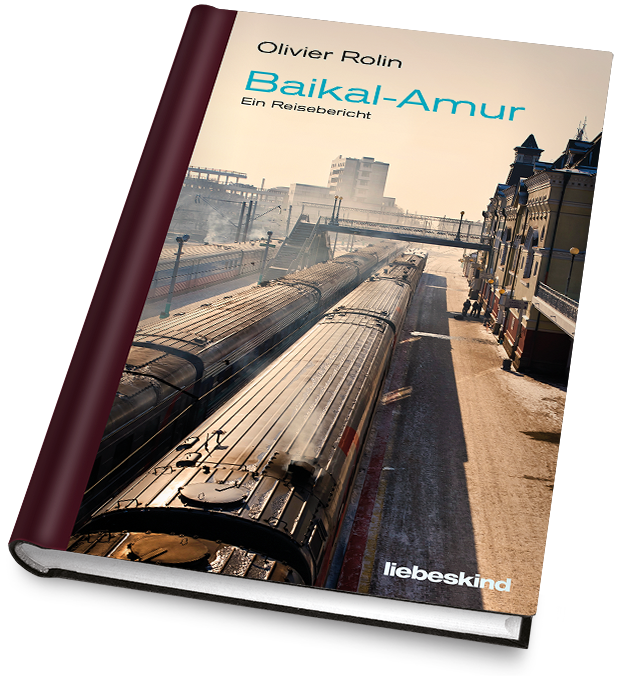
OLIVIER ROLIN. BAIKAL-AMUR. EIN REISEBERICHT
Fast 4287 km Strecke Schienenweg vom Herzen Sibiriens bis zum Ende Eurasiens, fast 150 Stunden in Zügen, legt Rolin bis zum Pazifischen Ozean zurück - vorbei an u.a. vom Gulag-System geprägten Städten und Landschaften, wo Verfall und Zerfall unmittelbar nebeneinander und die Opfer der unter nur schwer vorstellbarem Leid geleisteten Aufbauarbeit meist nur wenige Zentimeter unter der Erde liegen. Rolin begegnet Landschaften, Städten und Menschen, vor allem ihren Geschichten mit großer Neugier und Offenheit, manchmal auch mit verständlicher Distanz und leisem Humor. Stets wahrt er dabei Respekt und Bewunderung für menschliche Überlebenskraft und Überlebenswillen: „und (ich) begreife allmählich, daß dieses Land, diese Menschen Katastrophen erlebt haben, von denen wir uns keine Vorstellung machen und die es uns einfach nicht erlauben, sie nach unseren bequemen Gewißheiten zu beurteilen“.
Olivier Rolin zweifelt kokett, ob Reiseberichte überhaupt gelesen werden – diesen liest man ohne Zögern mit großer Begeisterung. Malcah Castillo
20€
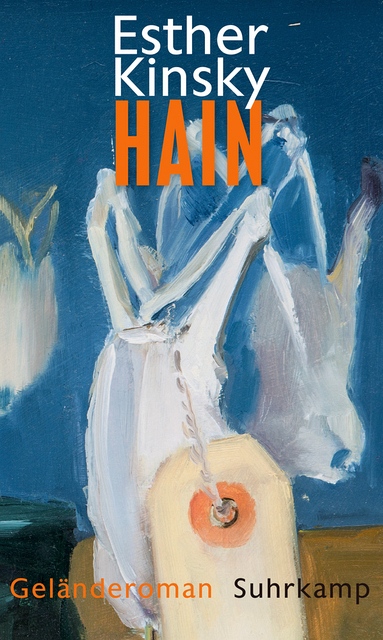
ESTHER KINSKY. HAIN. GELÄNDEROMAN
Suhrkamp, 287 Seiten, €[D]24,- | €[A]24,70
Man kann sich dem Sog dieses Buches nicht entziehen, obwohl (und das sei hier nicht als Warnung, sondern nur als erläuternder Hinweis zu verstehen) es nicht wirklich eine Handlung gibt auf diesen fast 300 Seiten. Aber sind nicht gerade diese Bücher oft die herausragenden? Die Jury des Leipziger Buchpreises teilt erfreulicherweise diese Einschätzung.
Von drei Italienreisen berichtet die Ich-Erzählerin, Reisen zur Unzeit (Januar) in wenig arkadische Gegenden Italiens: eine Kleinstadt nordöstlich von Rom, die Lagunenlandschaft der Poebene und buchmittig angeordnet die Fahrten mit dem etruskerverliebten Vater in den Siebzigern, Erinnerungen an die Kindheit.
Die Ich-Erzählerin beschreibt, was sie sieht, erinnert, träumt. Es geht um Verlust, intensivste Trauer, Abwesenheitsnotizen, um eine Wiedergewinnung an Boden – oder sagen wir besser Augenhaftung. Präzision, Sinnlichkeit und Distanz prägen diesen Text. Und eben deshalb weisen viele Passagen über das Gesagte hinaus. „Hat es Sinn, auf eine Baumgruppe zu zeigen und zu fragen: 'Verstehst Du, was diese Baumgruppe sagt?' Im allgemeinen nicht; aber könnte man nicht mit der Anordnung von Bäumen einen Sinn ausdrücken, könnte das nicht eine Geheimsprache sein?“( Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik, dem Roman vorangestellt). Esther Kinsky schickt eine Erzählerin aus, die sich Kraft ihrer unendlich differenzierten, stilsicheren Wortwahl einer Welt vergewissert, der man nicht verloren geht, weil man sie in Literatur verwandeln kann: Das ist das Tröstliche an diesem Buch. Die Lektüre ist eine Schule des Sehens. Mit bewundernswerter Könnerschaft schafft Esther Kinsky aus Worten Bilder äußerer und auch (sparsam) innerer Landschaften. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es trotz einer so reichen und differenzierten Sprache ganz ohne Überhöhung und ohne jegliche Manierismen auskommt. Es ist sachlich, distanziert und trotzdem (oder gerade deshalb) anrührend und kostbar und weit entfernt von jedem Italienklischee. „Das Gelände lag roh im Tageslicht und trostlos bei Nacht, vielleicht sogar untröstlich über seine völlige Untauglichkeit – weder zur Landschaft noch zum Obdach wollte es sich eignen.“ Formal und stilistisch ein Meisterwerk von großer poetischer Kraft.
Silke Grundmann-Schleicher
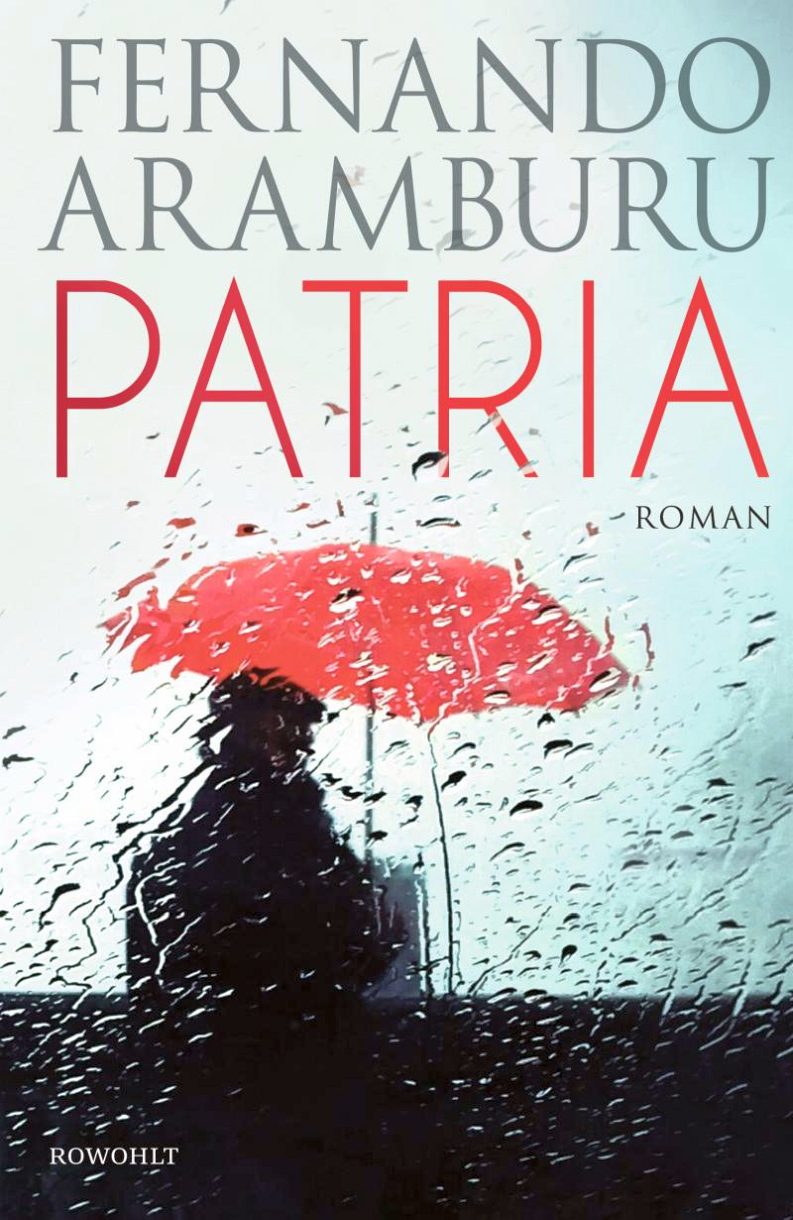
FERNANDO ARAMBURU. PATRIA
Rowohlt, 768 Seiten, € [D] 25,- I € [A] 25,70
Spanien Ende der 50er Jahre – seit 1959 kämpft die baskische Untergrundorganisation ETA militant für ein unabhängiges „Euskal Herria“ – ein politisch souveränes Baskenland links und rechts der Pyrenäen. Der baskische Autor Fernando Aramburu hat dieser Zeit ein überragendes und fesselndes Epos um zwei befreundete Familien, um die Verschränkungen von Opfern und Tätern der ETA, um den zähen Überlebens- und Lebenswillen des Menschen, um perfide Mechanismen wie Manipulation, Denunziation und Folter in ideologisch extremen Zeiten gewidmet.
Über zwei Generationen verknüpft Aramburu die Ereignisse seines Romans und umkreist nicht-chronologisch den eigentlichen Kern des Geschehens um die Ermordung eines Unternehmers durch die ETA aus unterschiedlichsten Perspektiven. Kann und will die Elterngeneration nicht vergessen, ringt die nächste Generation um ein eigenständiges Leben, frei von emotionalen und tragischen Hypotheken der Eltern. Mit ausgesprochener Sympathie und Verständnis für jede seiner Figuren stellt er dabei besonders die Frauen ins Zentrum: sie sind trotzig, standhaft, karg bis extrem lebenshungrig, auch schrullig und störrisch bis zum Aberwitz. Nicht immer sind sie die Klügeren, aber häufig die „Überlebenden“. In Zeiten erneuter regionaler Unabhängigkeitsbestrebungen, Radikalisierung und ideologisch aufgeheizter Debatten um Identität und Territorien ein wichtiger und darüber hinaus literarisch großartiger Roman, der 2017 mit dem renommierten Premio Nacional de Narrativa geehrt wurde. Malcah Castillo
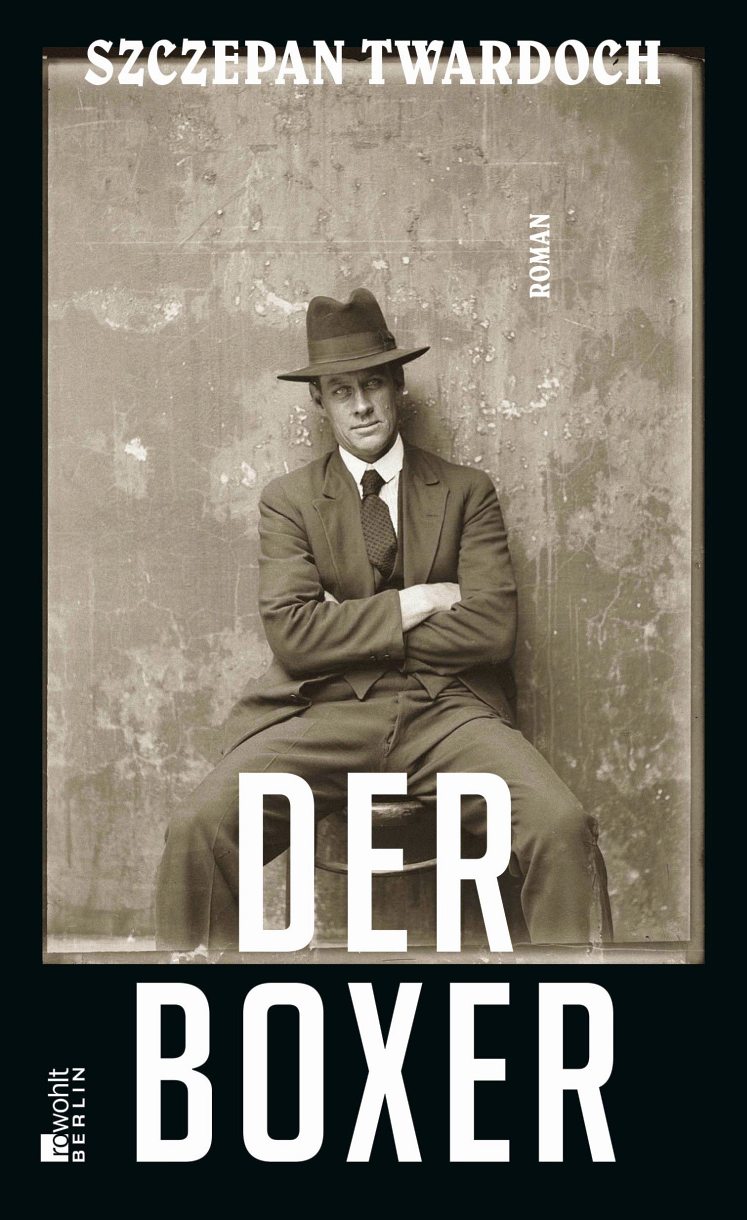
SZCZEPAN TWARDOCH. DER BOXER
Rowohlt Verlag, 462 Seiten, € [D]22,95 | € [A]23,60
In Tel Aviv sitzt Mojsche Bernstein/Inbar vor seiner Schreibmaschine. Er erinnert sich an das jüdische Warschau von 1937. Siebzehnjährig muss er miterleben, wie sein Vater von Jakub Shapiro verschleppt und getötet wird. Shapiro arbeitet für den „König“ der Warschauer Halbwelt, Jan Kaplica, treibt Schutzgeldzahlungen ein, mordet. Shapiro, ein Beau, ist nicht nur ein jüdischer Gangster, geachtet und bewundert in seinem Viertel, sondern auch der beste Boxer des jüdischen Clubs Makkabi. Er lädt Mojsche zu seinem Kampf gegen den besten rechtsnationalen Boxer des Clubs Legia Warszawa ein. Wie in einem Brennglas spiegeln sich in diesem Boxkampf und der ihn begleitenden Erregung der Zuschauer die politischen und sozialen Gegensätze zwischen jüdischem und polnischem Warschau. Shapiro nimmt sich des Waisen Mojsche an und führt ihn in die Warschauer jüdische Halbwelt ein. Man amüsiert sich ausgiebig, aber der politische Kampf zwischen dem linken, jüdischen Milieu und der nationalkonservativen, antisemitischen polnischen Gegenseite tobt, Raub und Mord sind an der Tagesordnung. Nach dem Tod von Jan Kaplica wird Mojsche zwei Jahre lang „König“ von Warschau. Er überlebt den Krieg. Viele der im Roman geschilderten Ereignisse sind tatsächlich passiert. Der Übersetzer Olaf Kühl erläutert im Nachwort die polnische Geschichte jener Zeit. Man sollte es zuerst lesen. Renate Georgi
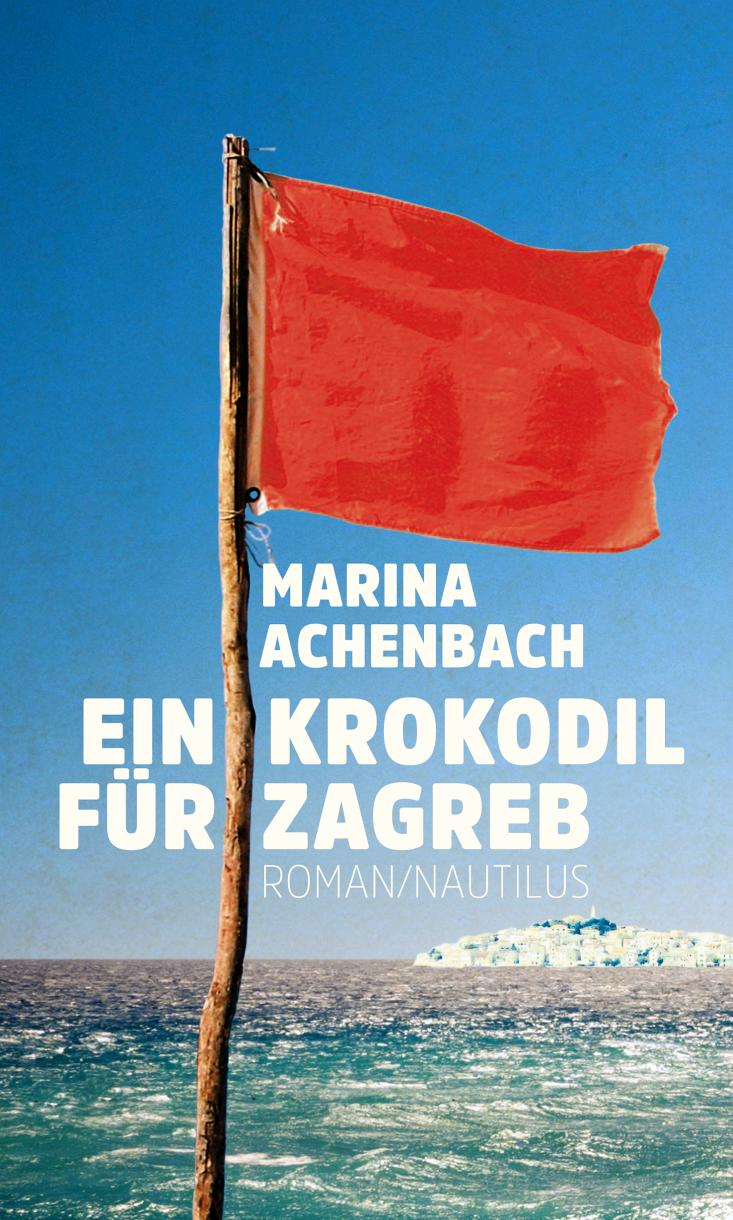
MARINA ACHENBACH. EIN KROKODIL FÜR ZAGREB
Edition Nautilus, 218 Seiten, € [D] 19,90 | € [A] 20,50
Als ein SA-Trupp an die Eisentür seiner Berliner Dachwohnung schlägt, flieht Ado von Achenbach aus Nazi-Deutschland zunächst nach Prag, dann weiter nach Jugoslawien, unter seinem Hemd ein kleines Krokodil. 1938 in Zagreb begegnet Ado der jungen Reporterin Seka: sie hat sich mit dem Emigranten zum Interview verabredet, weil er dem Zoo sein Krokodil schenken möchte. Diese Begegnung ist der Beginn einer großen Liebe.
In ihrem autobiografischen Roman Ein Krokodil für Zagreb erzählt die Journalistin Marina Achenbach die Geschichte ihrer Familie, verdichtet die Erinnerungen der Eltern und ihre eigenen in 120 Szenen. Dabei entsteht ein vielschichtiges, stimmungsreiches Bild aus persönlichen Erlebnissen und knapp skizzierten Gefühlen. Lebenswege, die bestimmt wurden durch die politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts.
Das Leben der beiden ist geprägt von vielen Brüchen und Wendungen: 1939 wird die Tochter Marina in Zagreb geboren, wenige Jahre später der Sohn Andreas; als die Wehrmacht einmarschiert, gehen sie nach Berlin, weil dort Ados Mutter Paula lebt. Bald flüchtet Seka mit den Kindern aus dem bombardierten Berlin nach Ahrenshoop, während Ado im KZ Leuna inhaftiert wird.
Nach Kriegsende lebt die Familie in der DDR: in Weimar verwirklicht Ado von Achenbach seinen Traum von einer Schauspielschule. Das Scheitern der Ehe, der plötzliche Tod des Vaters: 1957 zieht die Mutter Seka mit den Kindern nach München, wagt einmal mehr den Neuanfang.
Ein Krokodil für Zagreb ist ein wunderbarer, berührender Erinnerungsroman, der sich liest, als schlage man in Gedanken ein mit Fotografien prall gefülltes Album auf und blättere darin und blicke auf ein Jahrhundertleben – auf das der Mutter Seka.
Seka galt als begnadete Erzählerin, die Tochter Marina Achenbach setzt nun mit ihrem Buch auf hinreißende Weise die Familien-Tradition fort. Renata Seremet
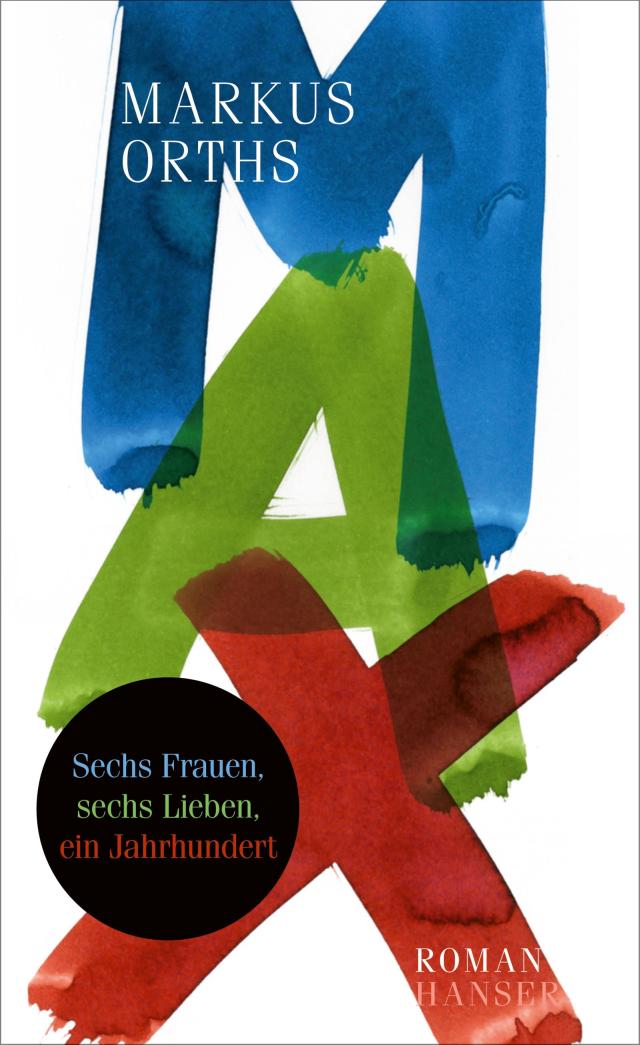
Markus Orths: Max
24,00€
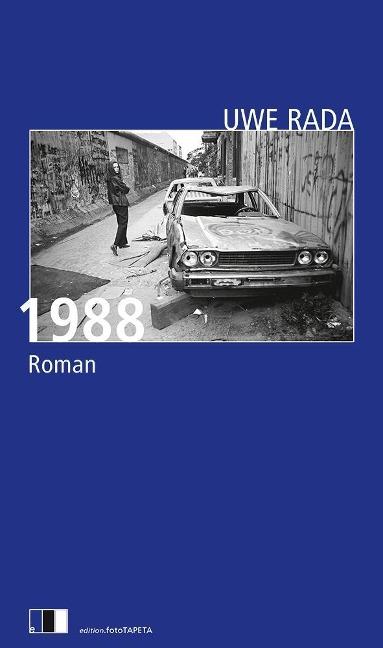
UWE RADAS: 1988
1988 wird in Westberlin noch der Revolutionäre 1. Mai zelebriert, das aber, was jenseits der Stadtgrenzen im Osten liegt, ist für die meisten Möchtegern-Revolutionäre und Pseudo-Internationalisten terra incognita, ein weißer Fleck auf der Landkarte: hic sunt leones. Dabei ist Berlin damals, ein Jahr vor der Wende, Kulturhauptstadt Europas, und im Kongresscentrum an der Spree, das damals noch nicht Haus der Kulturen der Welt hieß, träumen Schriftsteller aus Ost und West den Traum von Europa.
Manchmal kommt es wohl auch Jan so vor, als träume er, an den heißen Abenden im Sommer, bei seinen ersten Begegnungen mit Wiola, der ungreifbaren, schönen, eigensinnigen Wiola aus Krakau. Dreißig Jahre später, als Jan sich erinnert – inzwischen nicht mehr verkrachter Student, sondern Mann mit Frau und Haus am Berliner Stadtrand –, da ist er sich nicht mehr so sicher, ob dieser Traum damals nicht ein Albtraum war. Wiola hat ihm aus dem fernen Krakau, aus der Ferne der Erinnerung, einen Brief geschrieben: Jan, erinnern Sie sich? Natürlich erinnert er sich. Das ganze Buch ist eine Erinnerung. An Westberlin, das es nicht mehr gibt, an die Grenze, die es nicht mehr gibt, an eine Liebe, die es nicht mehr gibt, und an all die Fremdheit zwischen Polen und Deutschland, die es vielleicht immer noch gibt. Jedenfalls aber ist seither alles anders geworden, zwischen Berlin und dem Rest der Welt, zwischen Polen und Deutschland. Und zwischen Jan und Wiola? Das wird sich zeigen, bis zum überraschenden Ende.
„Uwe Rada versteht es, vergessene Geschichte wieder zum Leben zu erwecken”, hieß es im Deutschlandradio Kultur vor einiger Zeit über den Autor, der bekannt wurde durch seine wundersamen Bücher über große Flüsse. Jetzt also der Roman 1988, und wieder erzählt Rada Geschichte, die fast vergessene Geschichte einer Liebe und gleichzeitig die Geschichte einer schwierigen Annäherung zwischen dem Deutschen an Polen.
„Eine platonische Liebe ist und bleibt eine Liebe”, meint der Ich-Erzähler an einer Stelle seiner Reise zwischen Berlin und Krakau, zwischen damals und heute, die ihn zu einer neuen Begegnung mit Wiola führen soll, nach all den Jahren. Und mittlerweile weiß er auch: Selbst in dieser Liebesgeschichte wurde Geschichte verhandelt. Jan, der Revolutionsromantiker seiner jungen Jahre, wurde von Wiola die ganze Zeit mit Stoff eines für sie noch sehr präsenten, echten Romantikers versorgt, dem polnischen Nationaldichter Adam Mickiewicz. Die Gedichte Mickiewiczs sind die ganze Zeit mit dabei, bei diesem roadmovie zwischen Kreuzberg und Krakau, das zweimal abläuft: einmal 1988 und einmal heute. Der Vergleich, sehr gut erzählt, spricht buchstäblich Bände. sg
256 Seiten
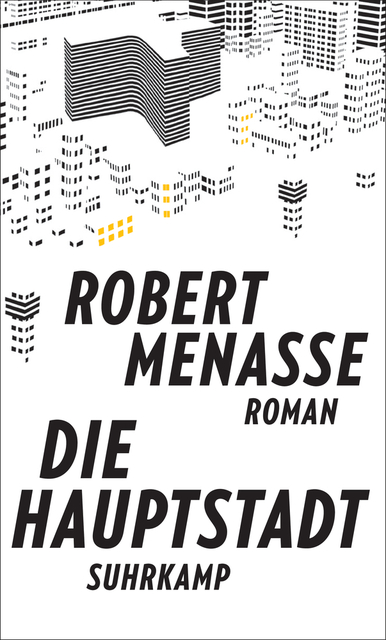
ROBERT MENASSE: DIE HAUPTSTADT. ROMAN
Alle reden von Europa.Wer oder was ist denn dieses Europa? Hat es überhaupt eine Haupt-Stadt?
Brüssel gilt als Haupt-Sitz der Institutionen der Europäischen Union. Parlamentssitz ist Straßburg, der Europäische Gerichtshof liegt in Luxemburg. „Zusammenhänge müssen nicht wirklich bestehen, aber ohne sie würde alles zerfallen.“ So das Motto des ersten Kapitels von Menasses Roman. Jedenfalls laufen in Brüssel alle Fäden zusammen, die von den unterschiedlichsten Akteuren aus 27 Staaten in den Händen gehalten, verknüpft, verknäult und manchmal wieder entwirrt werden müssen. So viele Sprachen, so viele Mentalitäten, so viele Charaktere, und sehr viel Persönliches fern der Heimat: Leid, Freude, Neid, Enttäuschung. Jeden Tag jagen sie ein neues Schwein durchs Dorf, genauer durch die EU-Länder. Mal sind es Vorschriften über die Krümmung von Gurken, andermal wird die Generaldirektion Kultur von der Generaldirektion Kommunikation beauftragt, das Ansehen der EU-Kommission aufzupolieren. Ihre Idee: ein Festakt zum Gründungs-Jubiläum unter dem Motto „ Nie wieder Auschwitz“. Schließlich lehrt die historische Erfahrung, formuliert vom Mitgründer der EU Jean Monet: „..Nationalismus führt zu Rassismus und Krieg, in radikaler Konsequenz zu Auschwitz.“ Aber das Projekt hat viele Tücken parat und Robert Menasse lässt mit wienerisch-jüdischem Humor die Handlungsstränge überraschende Wendungen nehmen. Dem Leser wachsen die handelnden Personen mitfühlend ans Herz. Hochaktuell. Selbst der Brexit wirft seine Schatten aufs Geschehen. Ein großes Lesevergnügen. js
459 Seiten
24,00€
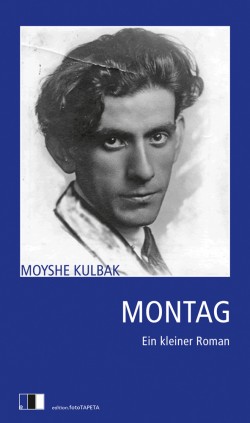
MOYSHE KULBAK: MONTAG. EIN KLEINER ROMAN
edition.fotoTAPETA
In diesem „kleinen Roman", 1926 in jiddischer Sprache in Warschau erschienen, steckt ein ganz, ganz großer. Hier sitzt jeder Satz, kein Wort zu viel, keines zu wenig: präzise, expressiv poetisch, philosophisch und visionär. Der Autor: ein gänzlich Unbekannter. Das wird sich nun ändern. Sie sollten dieses Buch unbedingt lesen.
Wovon erzählt es? In seinem Dachstübchen sitzt der Hebräischlehrer Mordkhe Markus über seinen Büchern und liest und denkt nach und liest und denkt nach. Ein Büchermensch, ein Gelehrter, in Würde arm aber reich an philosophischem und pädagogischem Impetus, ein liebenswürdiger Humanist und ein empathischer Idealist. Vor seiner Tür, auf der Straße, findet nicht weniger als ein Weltbeben statt: Schüsse fallen, Menschen werden erschossen, leiden Hunger. Es ist die Zeit der Russischen Revolution.
Mordkhe Markus ist ein Denker, kein Träumer. Er ist durchaus für die Veränderung der Gesellschaft, allein es fehlt ihm bei all diesem kommunistischen Geschrei etwas Entscheidendes: Freiheit! Er will einfach im Stillen studieren und nicht mit lauten Parolen agieren. Die Sache geht für ihn nicht gut aus. Moyshe Kulbak (1886 - 1937) ist für mich die größte literarische Entdeckung des Jahres. Wir verdanken dieses Buch dem seit zehn Jahren unermüdlichen Agieren eines kleinen Berliner Verlages. Was für ein Schatz hier gehoben wurde, erkennet jeder Sprach- und Literaturliebhaber sofort. Selten ist mir die russisch-jüdische Welt so nah gekommen. Immer wieder schmerzt der Verlust einer so radikal unumkehrbar vernichteten, großartig reichen Kultur. Ein Nachwort der Übersetzerin von hohem Informationswert gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie zum Verständnis dieses Buches und der Zeit, aus der es kommt, benötigen. Ein Glücksfall! Und sollten Sie Weiteres von Moyshe Kulbak lesen wollen, haben Sie dazu Gelegenheit: Ebenfalls gerade neu erschienen ist sein Roman "Die Selmenianer" im Verlag Die Andere Bibliothek. sg
111 Seiten
12,80€
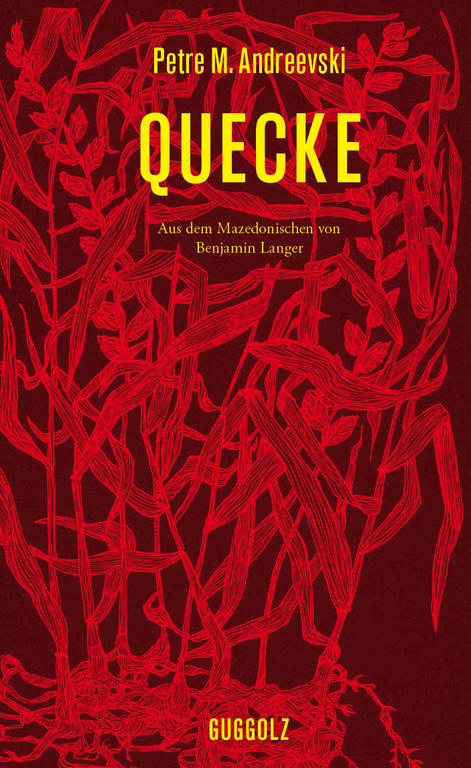
PETRE M. ANDREEVSKI: QUECKE
24
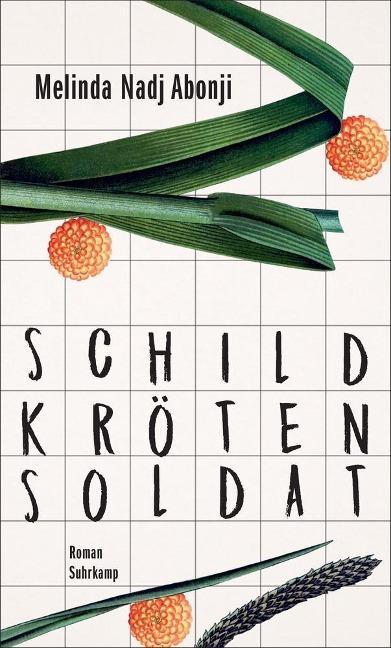
MELINDA NADJ ABONJI: SCHILDKRÖTENSOLDAT
42 €

Die Buchhandlung
an der FU Berlin
Königin-Luise-Straße 41
14195 Berlin
Telefon 030-841 902-0
Telefax 030-841 902-13
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr
Samstag: 10 - 16 Uhr
Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr
Shop: 24 Stunden täglich
Datenschutz bei Schleichers
Schleichers bei Facebook
Schleichers bei Instagram
✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren
✉ Newsletter abonnieren