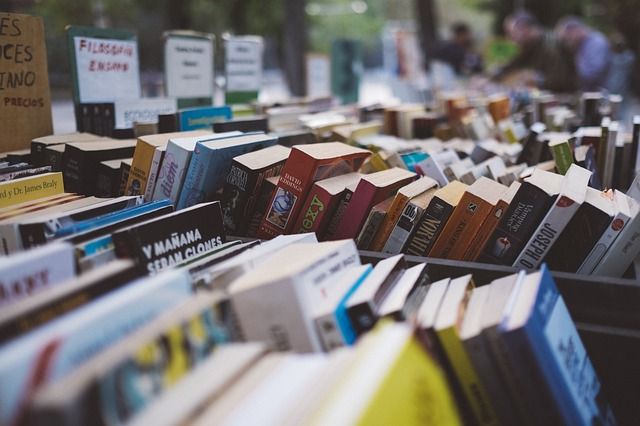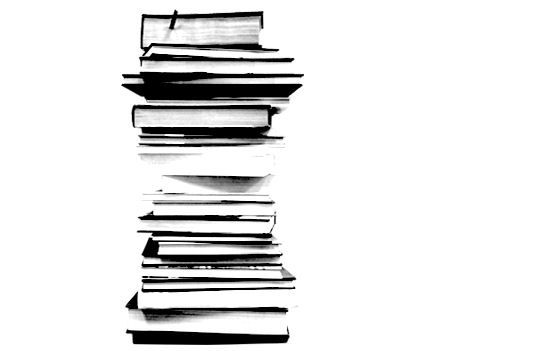Romane
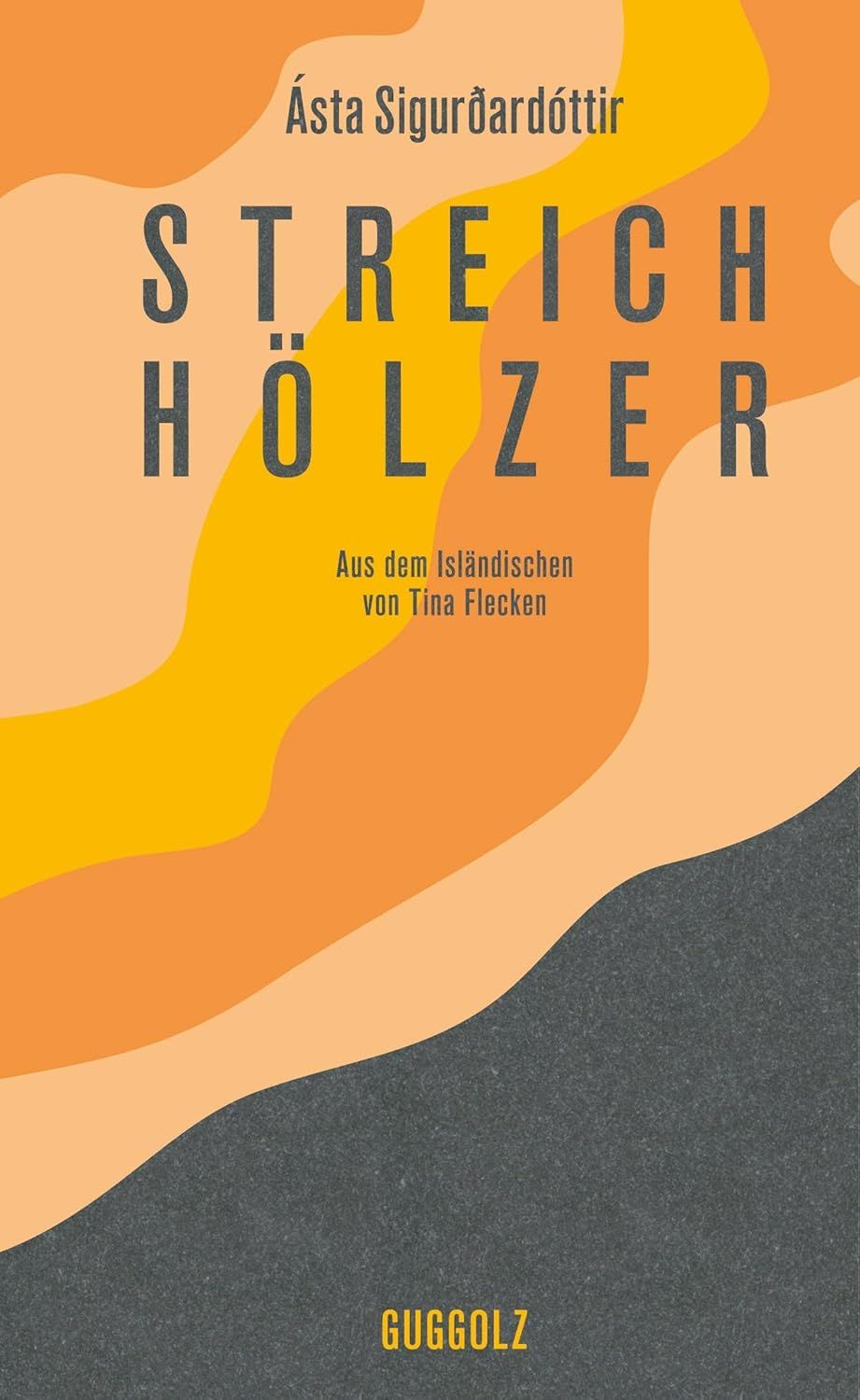
ASTA SIGURARDÓTTIR. STREICHHÖLZER
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
Guggolz Verlag
Was für eine Entdeckung! Es gibt ein Island vor den funktionsjackenbewandeten Touristenströmen, die heute die Insel heimsuchen, und jenseits aller Geysir-Romantik, dunkel-nebligen Fjord-Krimis und Mittelaltersagen. Zu verdanken ist die Entdeckung dem kleinen Guggolz Verlag, der Übersetzerin und vor allem natürlich der Autorin, die so unerhört ungeschliffen, rau, unerschrocken und zugleich zärtlich schreibt. Allzu viel ist über Asta Sigurardóttir (1930-1971) nicht zu erfahren. Sie starb mit kaum einundvierzig Jahren, brachte fünf oder mehr Kinder zur Welt und hinterließ ein kleines feines Werk. Ihre Lebensumstände müssen zeitlebens überaus prekär gewesen sein und von starkem Alkoholismus geprägt. Mitunter wird sie etwas euphemistisch als Islands erste „Bohémienne“ bezeichnet, wohl aufgrund der Tatsache, dass ihr eigenes Leben mindestens ebenso unkonventionell war wie das ihrer Protagonistinnen. Bürgerliche Konventionen und Moralvorstellungen im Island der Nachkriegszeit werden in Sigurardóttirs Erzählungen ausgehebelt: „Die Arbeitgeber musterten forschend meinen Bauch und spähten nach einem Ring an meinem Finger. Daraufhin schaute ich ebenfalls auf ihre Bäuche, die mir umfangreicher vorkamen als meiner. Ringe an den Fingern hatten sie auch – viele Ringe.“ Frauenfiguren, die wie das Urbild der Heiligen und der Hure daherkommen, tief verzweifelte junge Männer, gequälte Seelen und gequälte Körper – Sigurardóttir leiht ihnen ihre Stimme. Keine erbauliche Lektüre, aber eine verblüffende: Die Erzählungen wirken mutig und modern bis heute. Norma Cassau
221 Seiten
24 €
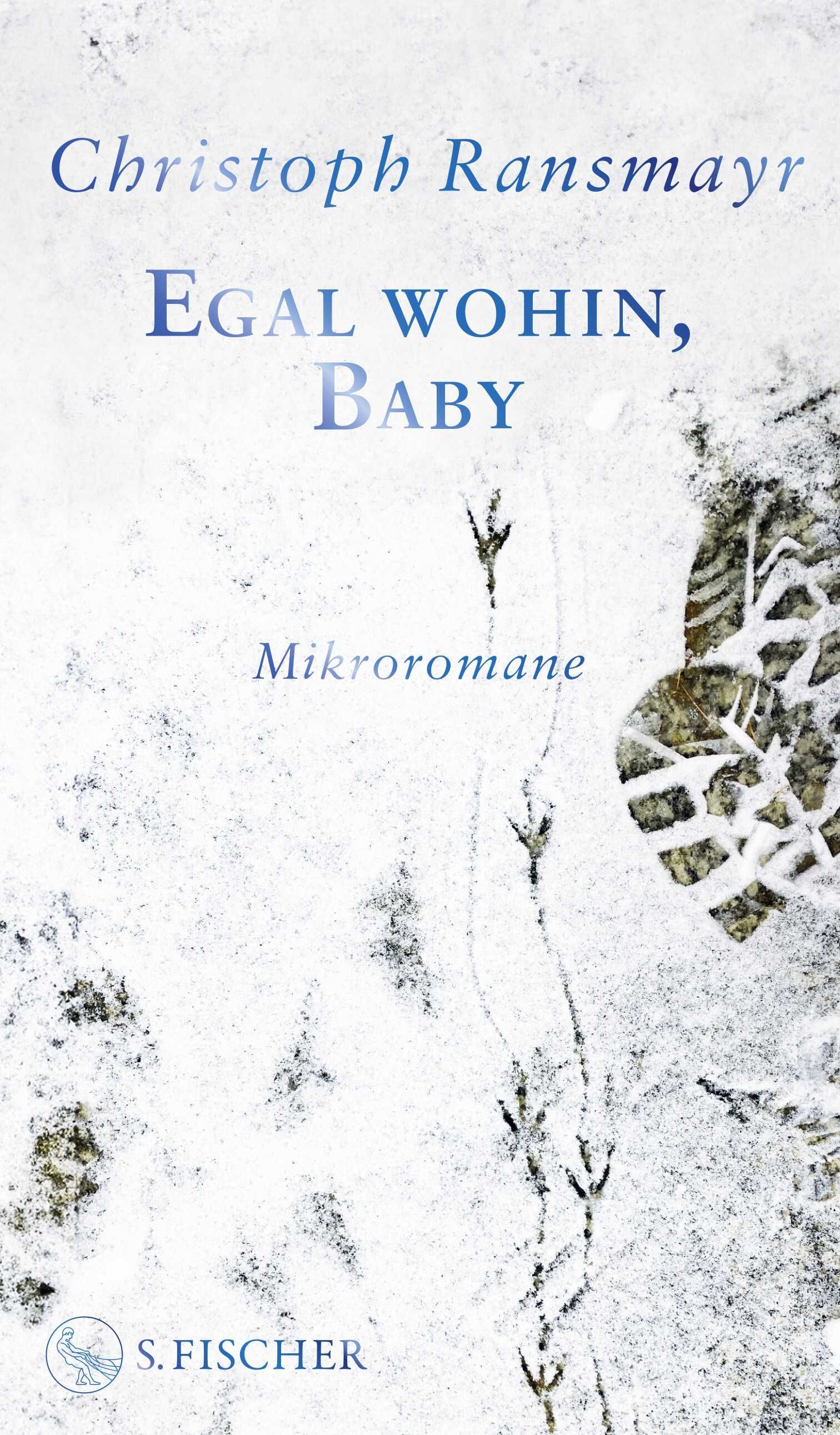
CHRISTOPH RANSMAYR. EGAL WOHIN, BABY. MIKROROMANE
S. Fischer Verlag
Ausgehend von flüchtigen Fotografien - das Wort Schnappschüsse trifft es genauer - der Autor spricht von „optischen Notizen“ - verwandelt Christoph Ransmayr Bilder, die von Erlebnissen, Eindrücken, Augenblicken und Erinnerungen eines Menschen erzählen, der viel gereist ist und immerzu unterwegs war in der Welt und dadurch eine „absolute Allergie gegen jede Form dogmatischen Denkens“ entwickelt hat, in Kleinstgeschichten, er nennt sie Mikroromane, die in ihrer Dichte, Schönheit und sprachlichen Präzision von der „Poesie des Alltags“ erzählen und weit darüber hinaus weisen. Egal, wohin uns der Dichter mitnimmt: Mexiko, Griechenland, Südpazifik, Cork oder Kongo, es sind sprachmächtige, eindrückliche Beschreibungen, die die Welt und das menschliche Dasein zur Sprache bringen. „Bemerkenswert dabei, in welchem chaotischen Wirbel sich Bilder und Erzählungen gelegentlich aneinander fügten“, das gilt auch für Schönheit und Schrecken. Die Welt und das Leben sind eben immer auch beides. „Komm! ins Offene, Freund!“ schallt es aus jedem dieser Mikroromane - wenn das kein Trost der Literatur in diesen Zeiten ist!
Silke Grundmann-Schleicher
256 Seiten
28 €
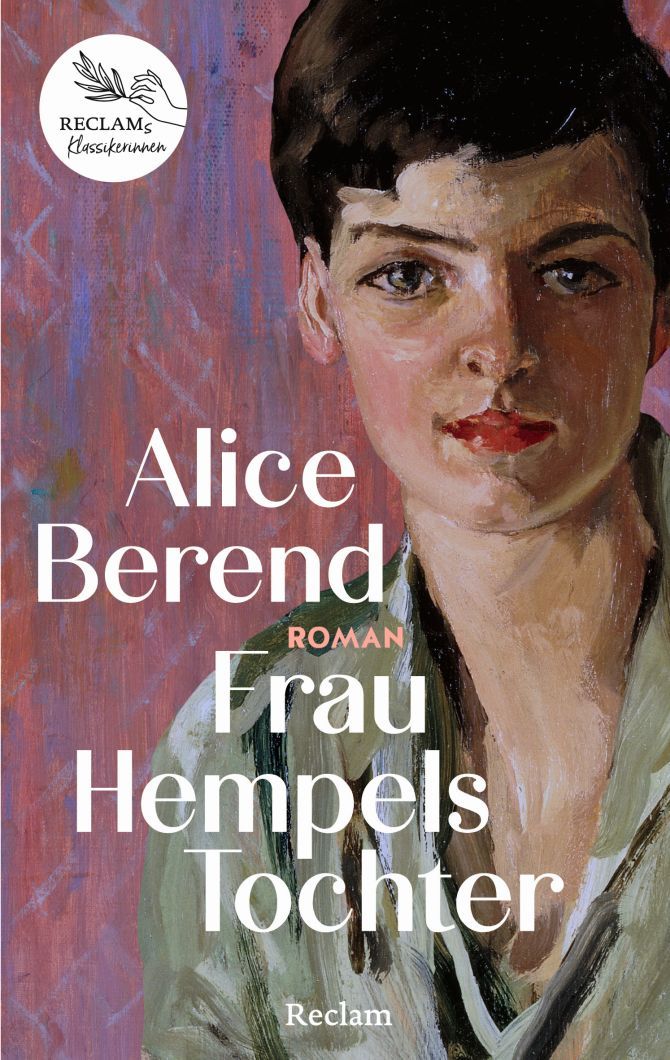
Alice Berend. Frau Hempels Tochter
Reclam Verlag
Die Schriftstellerin Alice Berend war in den 1910er und 20er Jahren sehr erfolgreich und wurde hoch gelobt – bis 1933 ihre Bücher verbrannt wurden. Nun ist ihr Roman „Frau Hempels Tochter“ in einer besonders schönen Ausgabe bei Reclam neu aufgelegt worden. Die Geschichte handelt von der Familie Hempel, die Hausverwalterin eines Mietshauses mitten in Berlin ist, in dem verschiedene Milieus aufeinandertreffen. Die Tochter Laura hat wenig Chancen, gut zu heiraten. Genau das wünscht sich Mutter Hempel für sie – eine bessere Zukunft und legt darum über die Zeit Geld beiseite. Laura, die als Kindermädchen für das Neugeborene der Vermieter arbeitet, verguckt sich vom Fenster aus in einen jungen Mann, den verarmten Graf von Prillberg: Eine leise Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. Frau Hempel lässt währenddessen die Idee eines Häuschens außerhalb Berlins nicht los, und so schafft die Familie es hinaus aus der lauten Stadt ins Grüne, wo sie Pächter einer Badeanstalt wird. Auch der Graf kommt zu Besuch, aber nicht nur er macht Laura den Hof …
Eine wirklich empfehlenswertes Buch voller Witz und Herzenswärme, zugleich Berlinroman, Familien- und Liebesgeschichte. Ein Buch wie ein erster Frühlingstag. Johanna Hummelt
200 Seiten
22 €
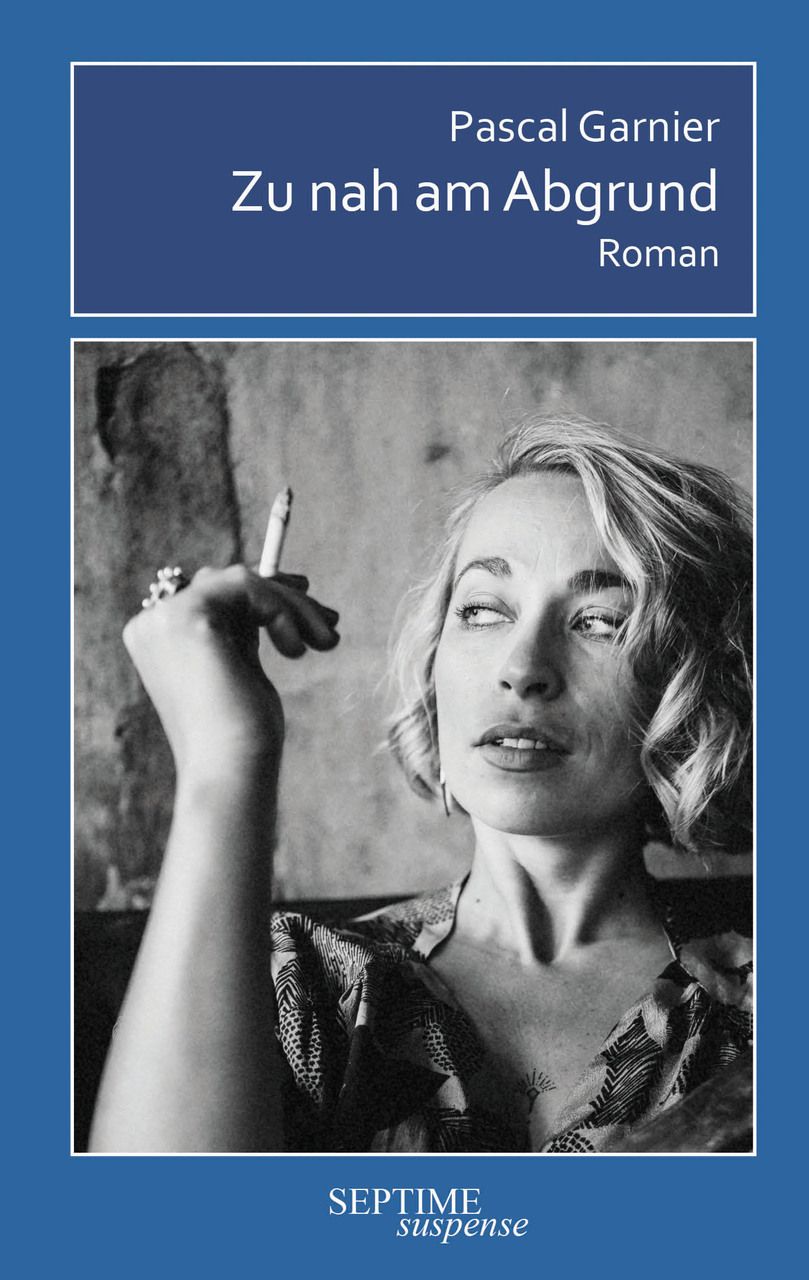
Pascal Garnier im Septime Verlag
ZU NAH AM ABGRUND
139 S. 20,-€
DIE INSEL
161 S., 22,-€
Aus dem Französischen von Felix Mayer
Septime Verlag
In Frankreich seit den 1990er Jahren bekannt und fast schon ein Klassiker des roman noir, liegt Pascal Garniers Werk nun endlich in deutscher Übersetzung vor.
Als Folie für die gelangweilten, dahintreibenden Figuren und ihre Abgründe dient dem Autor die etwas eintönige französische Provinz. Die Charaktere suchen die Veränderung nicht, ergreifen aber dennoch vermeintlich gute Gelegenheiten, aus ihrem Alltag auszubrechen.
In Zu nah am Abgrund gibt die bürgerliche, scheinbar in sich ruhende Mittsechzigerin Éliette, die nach dem Tod ihres Mannes in das Ferienhaus in der Ardèche gezogen ist, alles, um ein spätes Glück mit dem Kleinganoven Étienne zu leben, auch wenn es das eine oder andere Opfer kostet.
Noch finsterer wird es in dem Roman Die Insel, in dem der obdachlose und vorzeitig gekündigte Weihnachtsmann Roland das Festessen bei dem blinden Rodolphe, seiner Schwester Jeanne und ihrer Jugendliebe Olivier in Versailles nicht überlebt. Die drei verbliebenen Gastgeber haben nicht nur ein Problem damit, die Leiche zu entsorgen, sondern auch, einander zu trauen, da nicht klar ist, wer den Mord begangen hat.
Die schmalen Bändchen haben es in sich. Kunstvoll und mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor erschafft Garnier aus einer scheinbar friedlichen eine immer düsterer werdende Welt in der Tradition von Simenons psychologischen Romanen. Christine Mathioszek
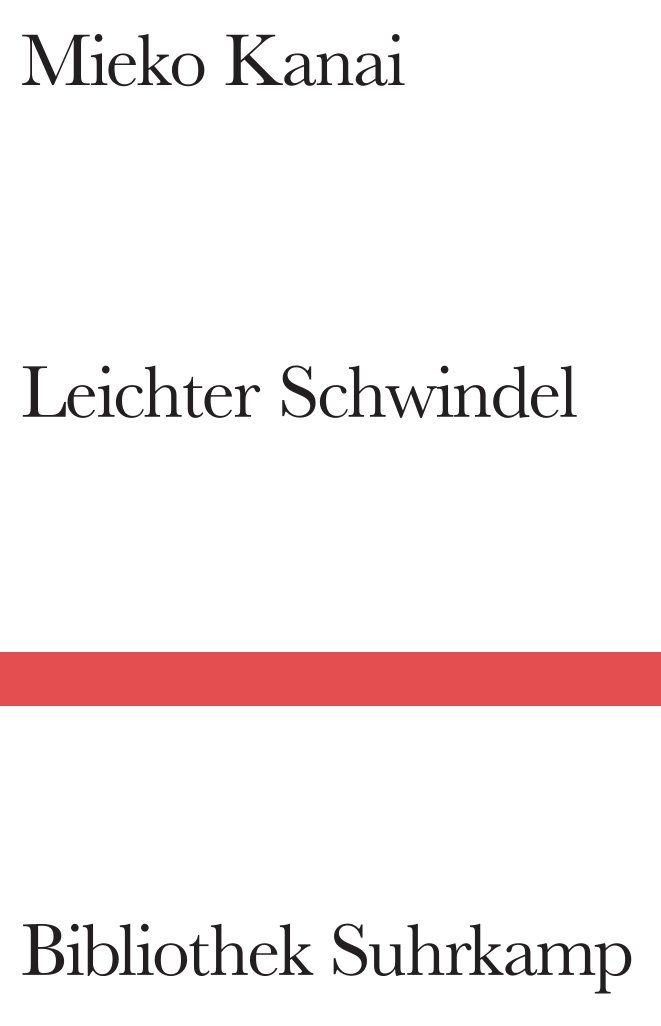
Mieko Kanai. Leichter Schwindel
Aus dem Japanischen von Ursula Graefe
Suhrkamp Verlag
Natsumi, Ende dreißig, lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einer Neubauwohnung am Rande Tokios. Sie ist nicht mehr berufstätig und fühlt sich in ihrem ereignislosen Hausfrauenleben gefangen. Zwar maßlos stolz auf ihre neue Wohnung, die sie ganz nach dem Vorbild der Hochglanzzeitschriften eingerichtet hat, entspricht das neue Zuhause dennoch nicht ganz ihren Vorstellungen.
Natsumi spürt die Begrenztheit ihres Hausfrauendaseins, sie langweilt sich, fühlt sich einsam und traurig, leidet an der Mittelmäßigkeit ihres Daseins, inklusive Ehemann.
In manchen Momenten ihrer alltäglichen Pflichten lässt Natsumi ein leichter Schwindel innehalten. Etwas für sie nicht Fassbares will an die Oberfläche ihres Bewusstseins, eine tiefsitzende Angst vor Auflösung droht sie zu überwältigen. Doch der Moment dauert nur kurz, dann gleitet sie weiter durch ihren monotonen Tag. Hat sie nicht von ihrer Mutter verinnerlicht, Glück bedeute Mittelmaß und Ereignislosigkeit?
Es gibt keine dramatischen Ereignisse in diesem Roman, keine Katastrophe und keine Scheidung. Mieko Kanai will das Alltägliche, das Unspektakuläre sichtbar machen. Es ist der schleichende Prozess einer Zersetzung, erzählt mit kühler Distanz und präziser Sprache.
Die Autorin hat damit den Nerv einer ganzen Generation getroffen. Es ist ein soziales Porträt einer noch immer von starken patriarchalischen Strukturen bestimmten Gesellschaft. Bereits 1997 in Japan erschienen, wurde ‚Leichter Schwindel‘ zum Kultbuch weiblichen Schreibens. Nun ist es auch auf deutsch erschienen und eine literarische Entdeckung. Sibylle Schulze-Berge
174 Seiten
23 €
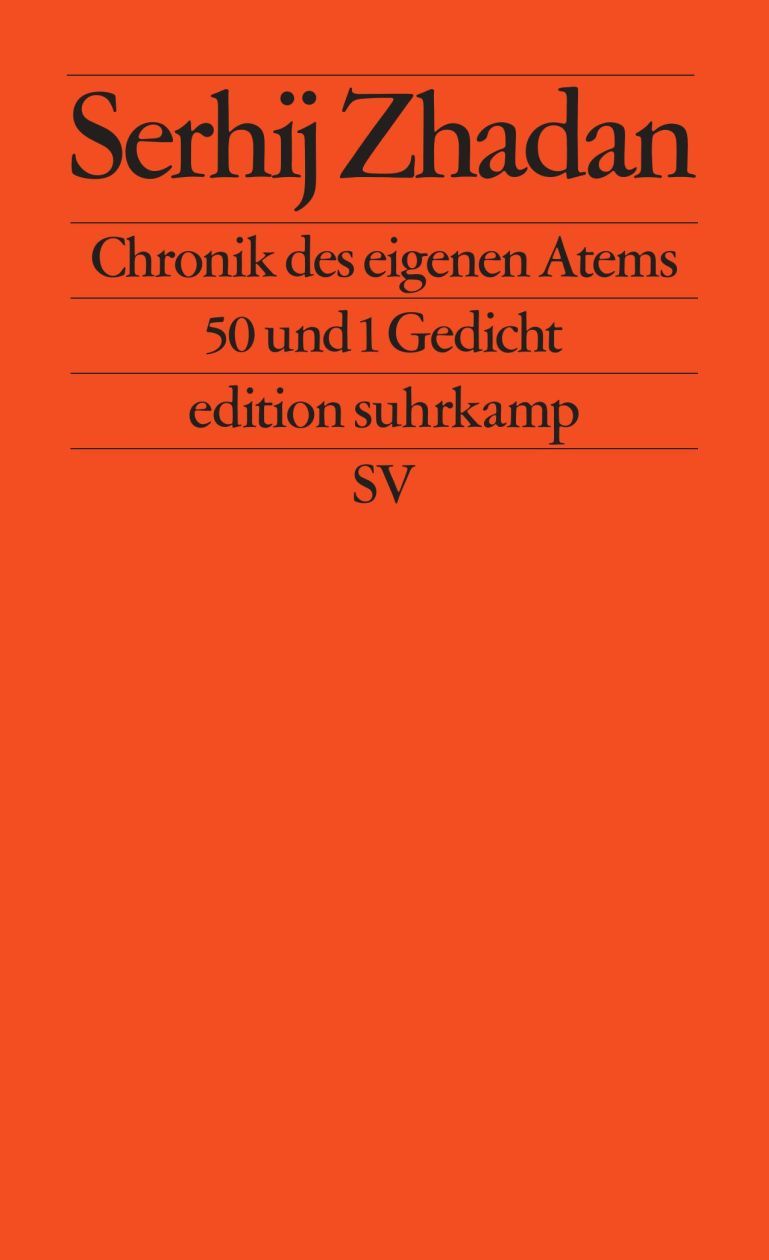
Serhij Zhadan. Chronik des eigenen Atems. 50 und 1 Gedicht
Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe
Suhrkamp Verlag
„Der Weg hier ist markiert von Stimmlosigkeit“, heißt es in einem Vers. An der Grenze einer dröhnenden Stille bewegen sich Serhij Zhadans neue Gedichte, Meldegänger des Lebens. Chronikartig aufgezeichnet vor und nach dem 24. Februar 2022 in und um die ukrainische Metropole Charkiw, klafft in ihrer Mitte eine Zäsur von vier Monaten, in denen Zhadan – Lyriker, Erzähler, Übersetzer, Sänger - als freiwilliger Helfer und Hilfsorganisator zwar nicht schwieg, in denen aber für ihn an Literatur nicht zu denken war. Diese Mitte, Tage und Wochen von Beschuss und Zerstörung, aber auch einer großen Solidarität unter den in der Stadt Verbliebenen, dichterisch zu bezeugen, das heißt, ohne Leere und Tod, mit denen der Feind um sich schlägt, um Wörter zu vermehren, erweist sich zunehmend als Thema und Aufgabe der 51 so behutsamen wie entschiedenen Gedichte. Der ständig drohenden, auch geistigen Vernichtung vermögen sie eine Sprache, Leben entgegenzusetzen. „Vielleicht sollte ich genau jetzt beginnen. // Sosehr ich mir auch sage, dass nicht die Zeit ist, / dass ich Worte nicht unbedacht aussprechen sollte, / die nicht richtig in der Stimme liegen, / die nicht in den Büchern des vergangenen Lebens stehen.“ - Im Frühling werden auch neue Geschichten von Zhadan erscheinen. Titel: „Keiner wird um etwas bitten“. Maximilian Pötzsch
124 Seiten
20 €
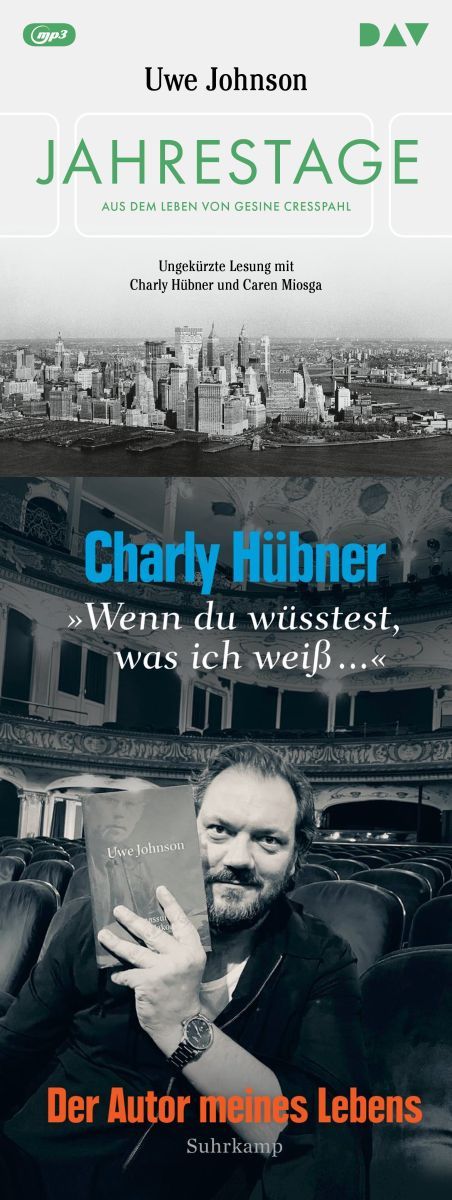
UWE JOHNSON
UWE JOHNSON. JAHRESTAGE. AUS DEM LEBEN VON GESINE CRESSPAHL
Ungekürzte Lesung mit Charly Hübner und Caren Miosga
DAV Deutscher Audioverlag, 73h und 53 Minuten
60 €
CHARLY HÜBNER
„ WENN DU WÜSSTEST, WAS ICH WEISS...“
DER AUTOR MEINES LEBENS
Suhrkamp Verlag, 125 Seiten
20€
Wie sehr die Jahrestage laut gelesen sein wollen, das wusste Uwe Johnson. „Ich habe das Buch so geschrieben, als würden die Leute es so langsam lesen, wie ich es geschrieben habe… Ein Jahr habe ich Dir gegeben. So unser Vertrag. Nun beschreibe das Jahr.“ Keine Angst: Sie brauchen kein Jahr, obwohl, diese zeitliche Korrelation hätte etwas. Dass es einmal zu dieser so wunderbaren Einlesung kommen würde - 40 Jahre nach Fertigstellung des vierten und letzten Bandes - er wäre einverstanden gewesen.
Wer, wenn nicht Charly Hübner, selbst Mecklenburger, und großer, bekennender Johnson-Fan (das Buch über Johnson lohnt sich vorab zu lesen, um in den Kosmos einzudringen), hätte es denn sonst machen und vor allem so machen können.
Und dann setzt es an, dieses unfassbarste aller großen Werke des 20. Jahrhunderts, eine weltumspannende Familiensaga, beginnend in den 30er Jahren an der mecklenburgischen Ostsee, hinein und hinüber bis ins New York der 1960er. Was macht ihn aus, diesen Roman? Genauigkeit, Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit, Humor, Wissen, Menschlichkeit und eine Geschichte von einem unglaublich „politisch-historisch-aufklärerischem Rang“. Sein Deutsch ist wunderbar irritierend rhythmisch und sehr eigenständig, komplex und überaus empfindsam gleichermaßen. Sein Umgang mit Zeit und Erinnerung meisterhaft. All das ist diese Hörbuchfassung ebenfalls - meisterhaft und preisgekrönt! sg
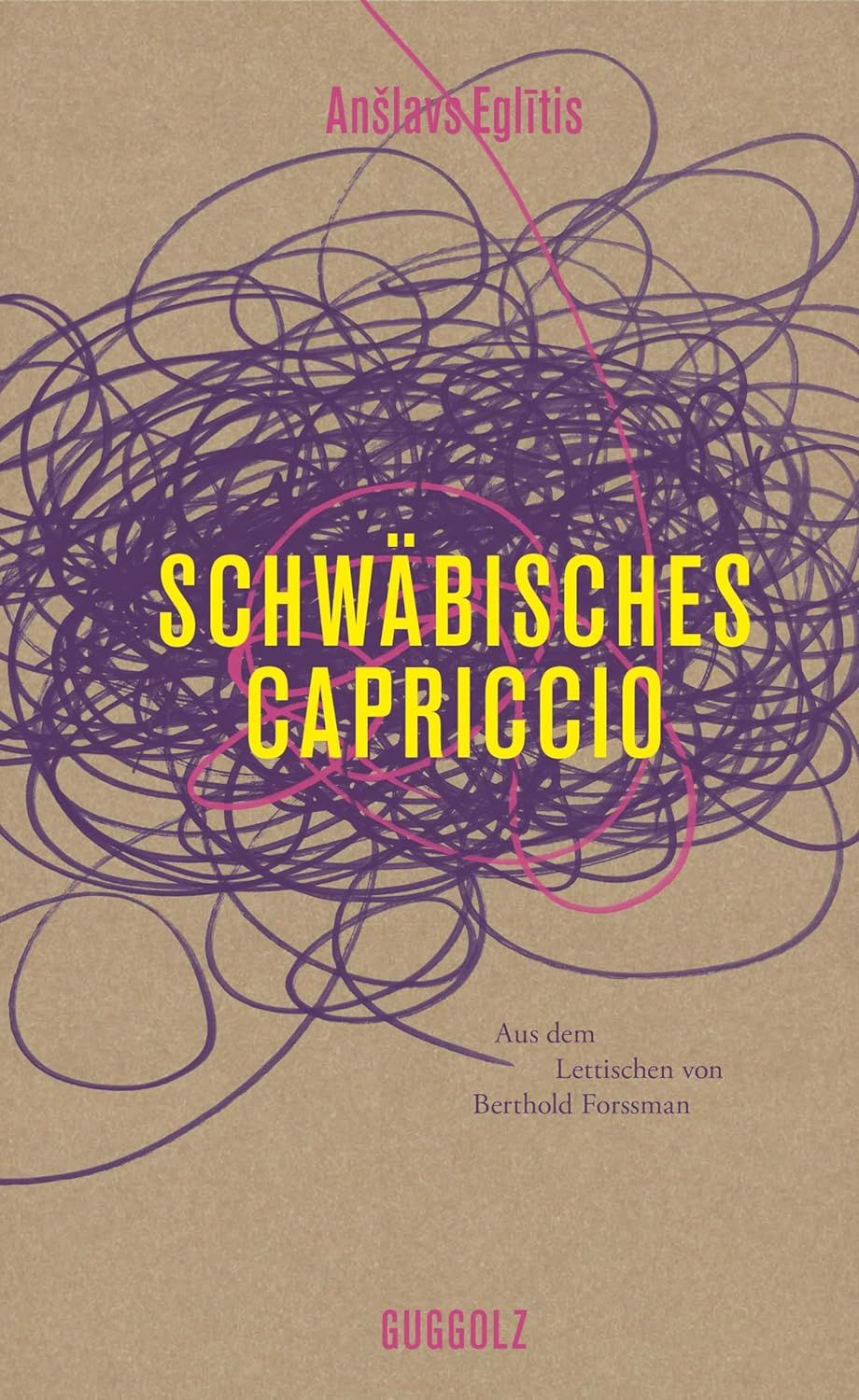
ANŠLAVS EGLĪTIS. SCHWÄBISCHES CAPRICCIO
Aus dem Lettischen von Berthold Forssman
Guggolz Verlag
Der 2014 gegründete und besonders ost- und nordeuropäischer Literatur verpflichtete Berliner Guggolz Verlag hat eine unbedingt (!) lesenswerte Buchperle des lettischen Autors Anšlavs Eglītis (1906-1993) neu herausgegeben.
In kleinen bitterbösen Geschichten und schelmischen Episoden um den fiktiven Ort Pfifferlingen auf der Schwäbischen Alb blättert Eglītis eine bäuerliche, materiell wie geistig beschränkte Welt mit trügerisch idyllischem Charakter auf. Es blühen Geiz, schildbürgerhafter Kleingeist und Verschlagenheit. Mit Geschehnissen der Weltgeschichte arrangiert man sich patent-pragmatisch und im Idealfall mögen dramatischere Ereignisse und Fremde vorüberziehen. Eglītis erfasst mit feiner Beobachtungsgabe und beissend hintergründigem Humor die zersplitterten Realitäten und den Irrsinn der europäischen Kriegswelt der Jahre um 1944, die ihm auf der Flucht vor der Roten Armee ins Exil über Berlin auf die Schwäbische Alb begegnen.
Am Anfang dieses autobiographisch grundierten Buches formuliert Anšlavs Eglītis in knappen Worten: „Alles Erlebte erschien ihm wie ein sinnloser Albtraum (…), die Flucht durch die Flammen, das Umherirren in den Trümmern“.
Trotz oder wegen dieser Erlebnisse hält er am Schreiben fest. Ein Glücksfall, denn fast filmreife Episoden wie „Die Lederuniformen“ möchte man nie mehr missen! mc
318 Seiten
25€
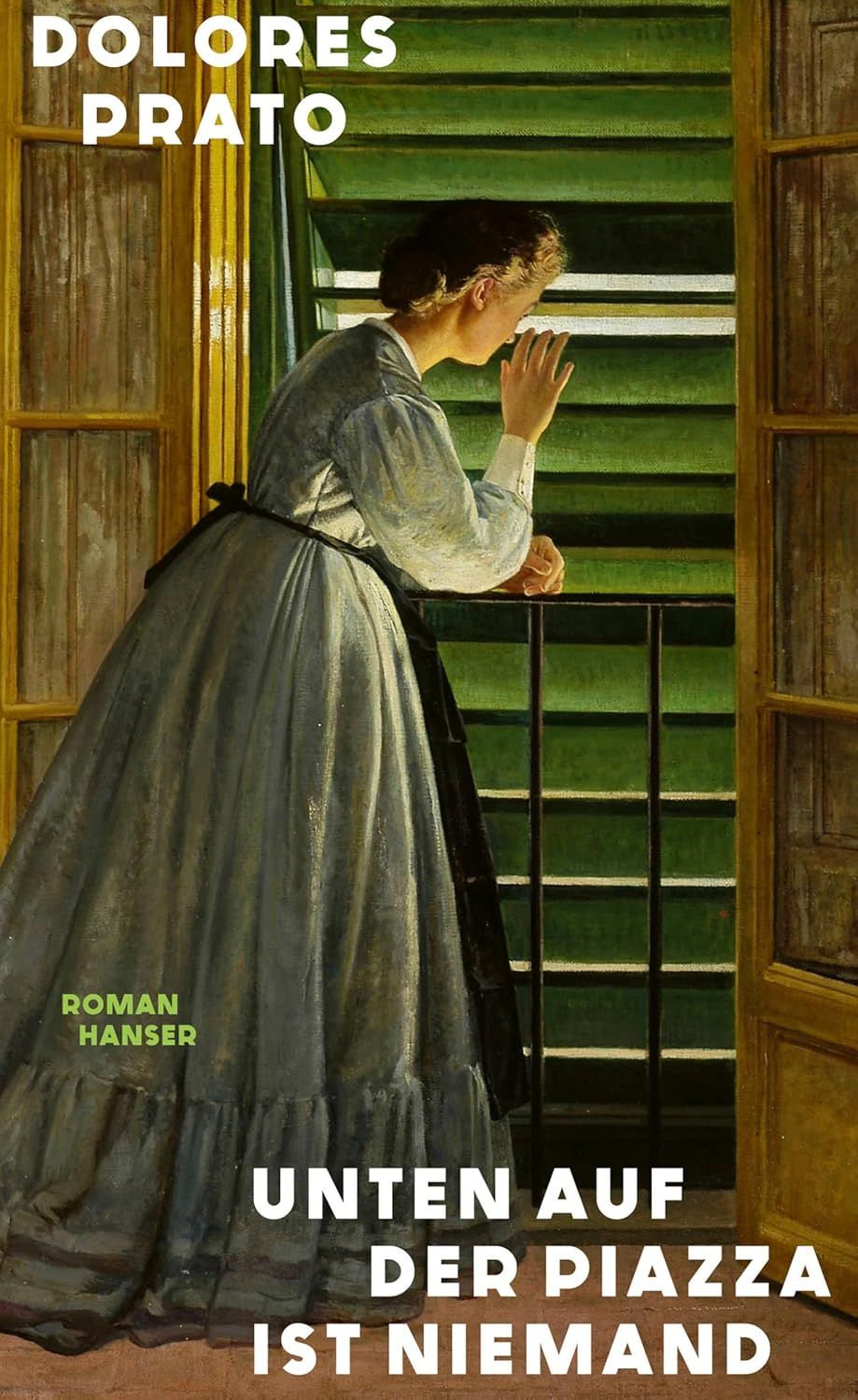
DOLORES PRATO. UNTEN AUF DER PIAZZA IST NIEMAND
Aus dem Italienischen von Anna Leube
Hanser Verlag
Dolores Prato, die 1892 in Rom geboren wurde und fast hundertjährig 1983 starb, ist die Verfasserin dieses einmaligen Werkes. Es ist recht unverhohlen autobiographisch, nämlich das Leben eines unehelich geborenen Mädchens, Dolò gerufen, das bei einer Tante und einem Onkel aufwächst, der Priester ist. Der Vater ist unbekannt, und die Mutter gab es weg. Sie taucht nur als Schemen im Leben ihrer Tochter auf, als Gesichtslose, als leere Worthülse, die das Kind beliebig anderen Frauen überstülpt, von denen es sich wünscht, gesehen, geliebt, gezärtelt zu werden. Ein Werk, angefüllt mit collagenhaft aneinandergefügten Szenen und labyrinthischen Beschreibungen von Markttagen, religiösen Bräuchen, volkstümlichem Leben, »das Heilige mit dem Alltagsleben vermischt« – keinem Plot folgend außer dem Mädchen, das sich selbst und uns der rote Faden ist. Man kann eine beliebige Seite aufschlagen und doch mit einem Mal das Ganze erfassen.
1980 erschien das Werk im legendären Einaudi Verlag, wo die Lektorin, die ebenfalls legendäre Natalia Ginzburg, den Text um zwei Drittel gekürzt hatte. Und es ist wahr, dieser wundervolle, reiche Text braucht Geduld und Hinwendung – aber braucht das nicht alle große Literatur? nc
978 Seiten
38 €
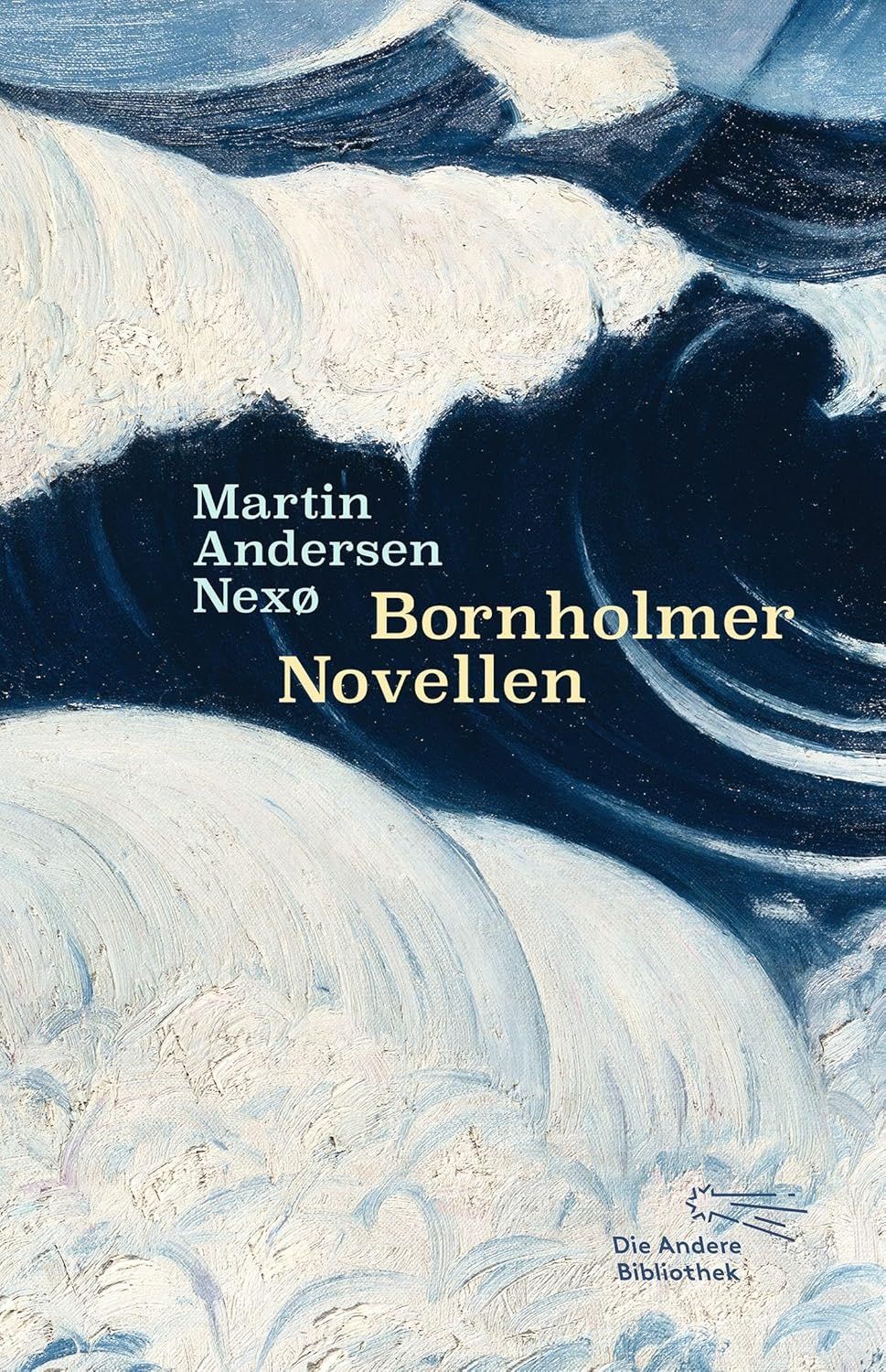
MARTIN ANDERSEN NEXØ. BORNHOLMER NOVELLEN
Die Andere Bibliothek
„Das Schicksal selbst kennt keine Nerven. Es geht über einen Menschen hinweg wie ein Eisenbahnzug, und man spürt nur ein weiches Wiegen.“
Acht Novellen sind in diesem wunderschönen, leinengebundenen Band versammelt. Es sind archaische Geschichten. Sie handeln von Familie, Arbeit,Tod, Versicherungsbetrug, Liebe, Täuschung, Verlust und dann auch wieder Glück. Man taucht ein in das oft raue und arbeitsreiche Leben auf der Ostseeinsel. Der Autor (1869-1954) verbrachte 20 Jahre auf Bornholm. Der Stil ist klar und prägnant. Es sitzt jedes Wort. In Sätzen oder Abschnitten werden ganze Schicksale abgehandelt. Wie dunkle Diamanten strahlen die Novellen einen Sog aus, dem man sich schwer entziehen kann. Absolut gekonnt verwebt Andersen Nexø Insellegenden und Tratsch zu scheinbar einfachen Geschichten, die einen allerdings mit ihrer Tiefe lange im Kopf bleiben. hd
220 Seiten
20€
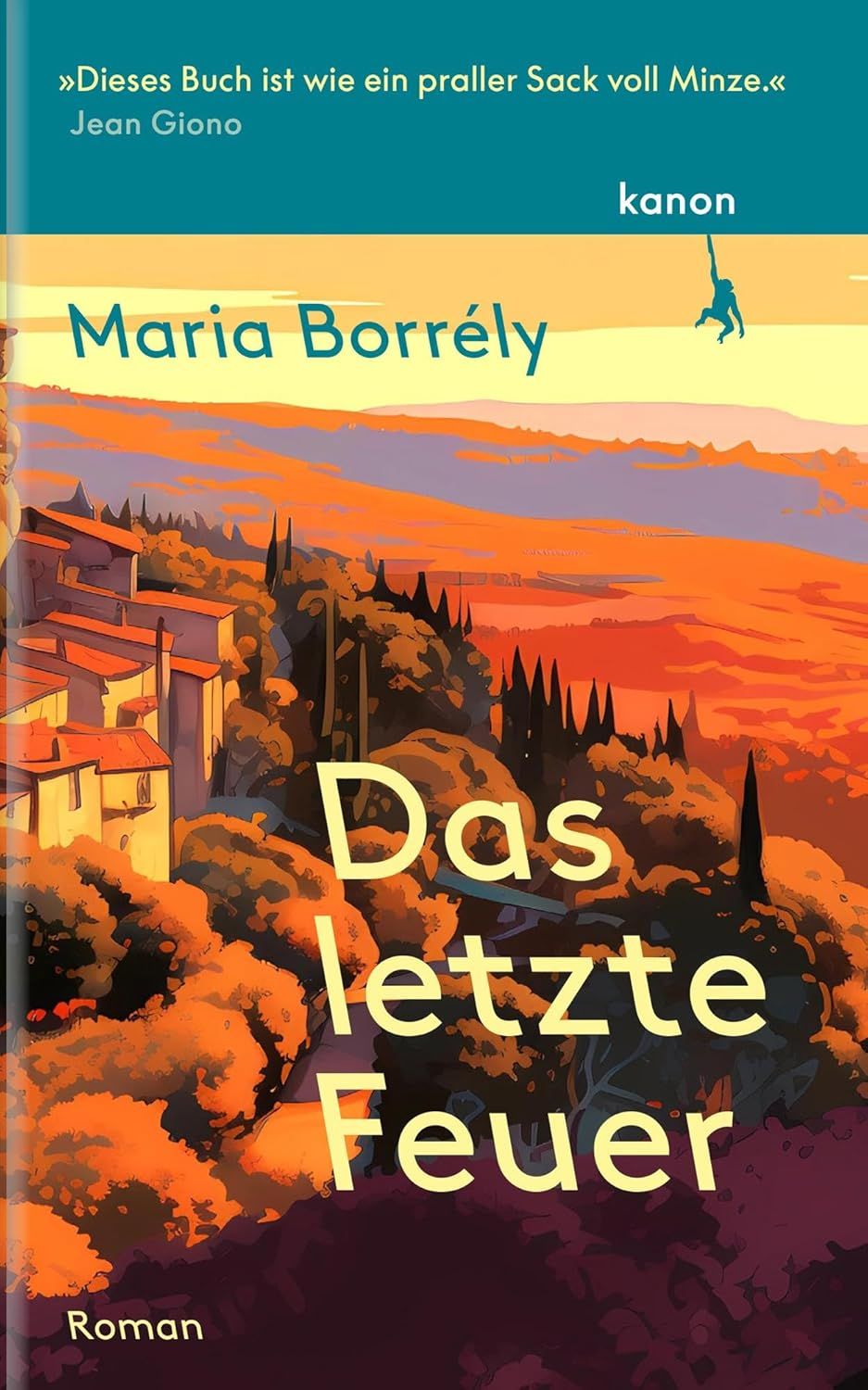
MARIA BORRÉLY. DAS LETZTE FEUER
Aus dem Französischen von Amelie Thoma
Kanon Verlag
Zu Unrecht ist die französische Schriftstellerin Maria Borrély in Vergessenheit geraten. Von Kollegen in den 1930ern geschätzt und unterstützt, schrieb sie vier Romane. Nach „Mistral“ veröffentlicht der Kanon Verlag nun auch „Das letzte Feuer“ zum ersten Mal auf Deutsch.
Die Bewohner des Bergdorfes Orpierre-d’Asse in der Haute-Provence leben beschwerlich. Die Natur ist rau, der Wind weht und der reißende Fluss Asse ist unberechenbar. Als dieser eingedeicht wird, ziehen sie nach unten ins Tal, froh, die Härte der Natur hinter sich zu lassen. Alle bis auf die alte Pélagie – ihr Feuer ist das letzte, das im Dorf brennt. Sie weigert sich, ihren Nachbarn zu folgen, selbst als ihre Enkelin Berthe sie verlässt, um zu heiraten. Denn sie ist überzeugt: die Asse lässt sich nicht zähmen.
Eine klassische Handlung mit Spannungskurve gibt es hier nicht. Dafür lässt die Autorin mit ihren Sätzen Bilder entstehen und zeichnet die Landschaft so klar, dass man meint, selbst dort oben zu sein. Durch die grandiose Übersetzung von Amelie Thoma ist es möglich, diesen verschollenen Klassiker nun auch auf Deutsch zu entdecken. jh
134 Seiten
20 €
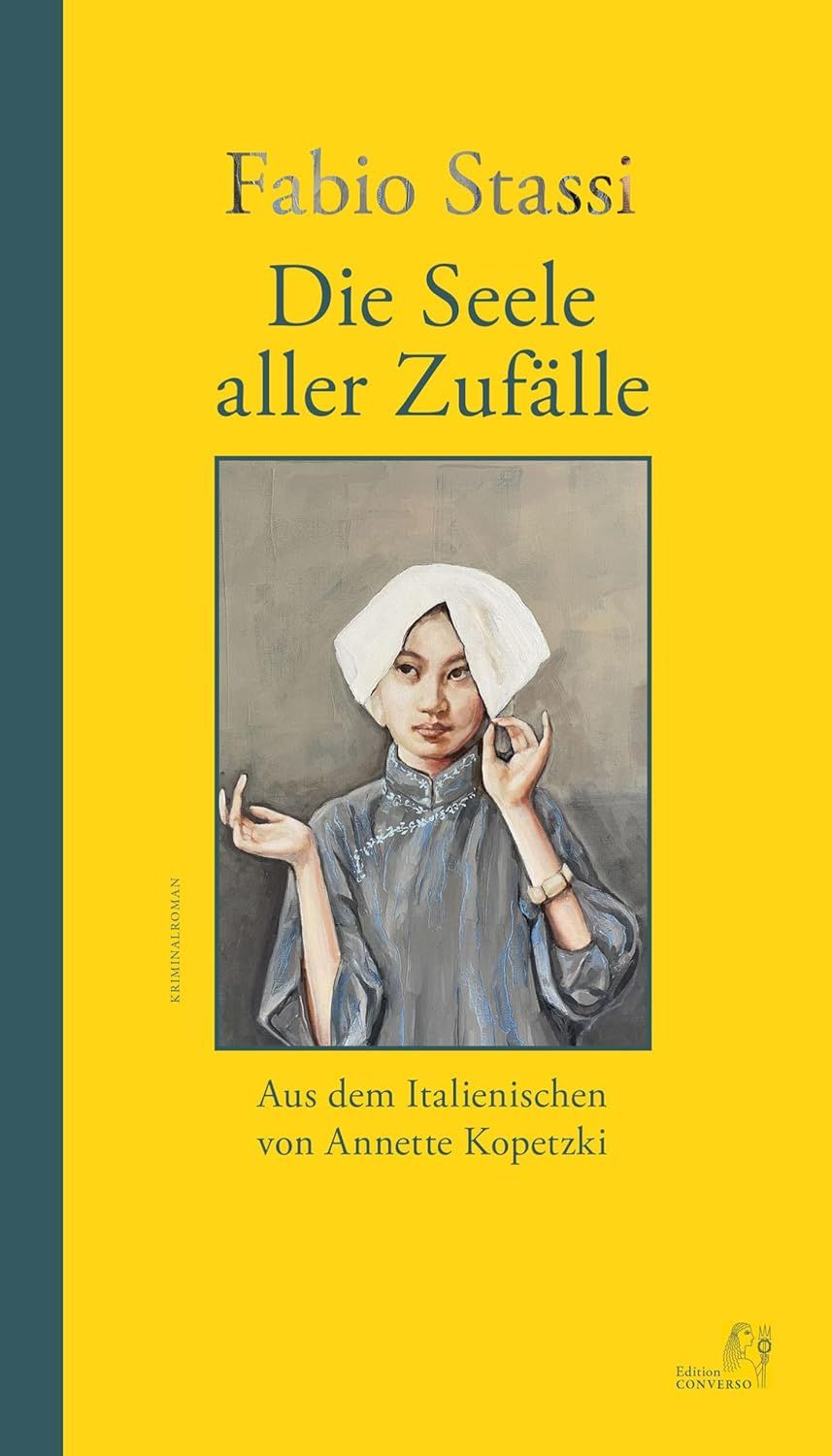
FABIO STASSI. DIE SEELE ALLER ZUFÄLLE
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Edition Converso
Vince Corso, ehemaliger Lehrer, nun Bibliotherapeut und Gelegenheitsdetektiv, führt uns in seinem dritten Fall durch Rom, Bibliotheken, die Literatur und ein kniffeliges Rätsel. Nebenbei lernen wir die unterschiedlichsten Bewohner seines Viertels kennen und bekommen so ein Bild der politschen und gesellschaftlichen Stimmung gezeichnet.
Ein an Alzheimer erkrankter Sprachgelehrter und Sinologe wiederholt stets die selben sechs unzusammenhängenden Sätze, und seine Schwester beauftragt Corso, das Buch zu finden, aus dem sie stammen, um ihm daraus vorzulesen und ihn zu erreichen.
Corso begibt sich auf die Suche und vermutet schnell andere Motive, als er sich mit der einzigartigen Bibliothek des Gelehrten vertraut macht.
Die detektivische Arbeit ist dabei weniger kriminalistisch als literarisch. Die unzähligen Referenzen und Zitate sind eine Hymne an die Literatur und das Lesen, deren Wirkkraft und -macht.
Sofort möchte man sich mit den erwähnten Büchern zurückziehen und dabei der Tonspur lauschen, die Stassi im Nachtrag empfiehlt. cm
281 Seiten
24€

Die Buchhandlung
an der FU Berlin
Königin-Luise-Straße 41
14195 Berlin
Telefon 030-841 902-0
Telefax 030-841 902-13
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr
Samstag: 10 - 16 Uhr
Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr
Shop: 24 Stunden täglich
Datenschutz bei Schleichers
Schleichers bei Facebook
Schleichers bei Instagram
✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren
✉ Newsletter abonnieren