Karl Schlögel. Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen
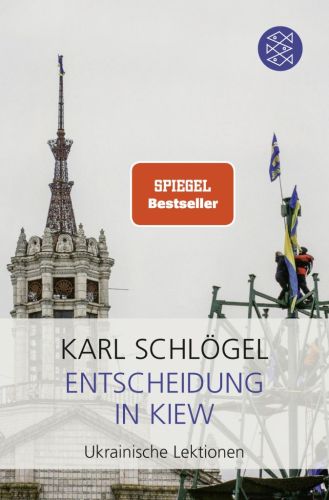
Nachdruck von 2015
Fischer Taschenbuchverlag
„Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird, ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird. Nur so viel ist gewiss: Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden,“ diese Sätze eröffneten vor sieben Jahren das Buch von Karl Schlögel.
Das war vor sieben Jahren! Vor sieben Jahren? Schwer zu beschreiben, wie Vergangenheit unmittelbare Gegenwart wird; ein Historiker erlebt das Wahr-Werden der eigenen Wahrnehmungen. Der „Kassandra“ der Christa Wolf gleich, vermag er allein deshalb die Zukunft zu sehen, weil er aufs Schärfste die Gegenwart in den Blick nimmt. Er hat 2015 nichts „vorhergesagt“, er hat „hervorgesagt“, was der „Westen“ nicht sehen wollte. Und er tat, was in deutscher Wissenschaft noch immer – vermutlich einmalig auf der Welt – spitz getadelt wird: Er ließ den Analytiker beiseite und wurde zum Anwalt. Und blieb Anwalt bis auf seine heutigen Worte zum verheerenden Krieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine („Die Unordnung im Kopf und die Unordnung der Welt“, 3. Mai, Frankfurter Rundschau, u.ö.). Wird der Anwalt zum Erzähler, der Historiker zum literarischen Städtemaler, faltet sich Geschichte in Meistererzählungen auf und wird endlich der Ad-vokat zu einem, der einen Anspruch erhebt, beginnen sich die Trennlinien zwischen Darstellung und Deutung aufzulösen, worauf er prompt von Fachkollegen den Status des „Außenseiters“ erhält, „wenngleich bewundert“, wie rasch hinzugefügt wird.Was gegenwärtig geschieht, ist für Schlögel der „Ernstfall“, das Ergebnis einer seit Jahren fast bewusstlosen Einstellung des Westens der Ukraine gegenüber, die nie mit einer Rückkehr der Bedrohung rechnete, eher in Verständnissehnsucht mit Moskau versank, als die mörderische Vernichtung Grosnys und Aleppos, die Kaperung der Krim wahrzunehmen. Er schilt den Ausfall von Aufmerksamkeit für die Ukraine. Lemberg, Brody und Czernowitz waren immer wichtiger und anziehender für die intellektuelle westliche Elite, als die von Russland bedrohte Realität dieser Städte, da hat Schlögel messerscharfe Bilanz gezogen, vor allem in seinem Czernowitz-Kapitel. Die acht Porträts ukrainischer Städte – Kiew, Odessa, Charkow, Dnipropetrowsk, Donezk, Czernowitz, Lemberg und Jalta – sind große Literatur!
Mir war es vergönnt, Lemberg, die Bukowina, aber auch Odessa auf Reisen intensiv zu erleben, Die Vorstellung, sie im 21. Jahrhundert in Schutt und Asche zu sehen, kommt einem apokalyptischen Alptraum nahe. Aleida Assmann verwies jüngst auf einem Abend in Verbindung mit dieser Buchhandlung auf die gezielte Auslöschung vieler Zeugnisse des kulturellen Gedächtnisses der Ukraine und plädierte anwaltlich passioniert wie Schlögel auf Widerstand und Solidarität.
Doch es ist schwer! Schlögel bilanziert das Ende der bisherigen Erinnerungskultur, weil die europäische Lage archaisch und postmodern raffiniert zugleich sei. Genozidale Strategien überlagerten sich, es gebe noch keine Theoriebildung zu dem, was in Babyn Jar, in Uman, in Mariupol geschehe. Schlögel spricht von einem „kleinen, niederträchtigen Diktator und Massenmörder“, der die Ehre der im Kampf gegen Hitler gefallenen sowjetischen Soldaten so sehr beschmutzt habe. Ein Bild Ernst Blochs helfe ihm, die Gegenwart irgendwie hilfsweise zu benennen: Wir leben im „Dunkel des gelebten Augenblicks“, in dem nur Mithilfe und Beistand gefordert sind, auf dass Europa eine Zukunft habe, eine Zukunft in Fülle und Vielfalt.
Ob hier eine Spur zum Verständnis Putins liegt?
Der gelernte KGB-Angestellte vermag die Vielfalt nicht zu ertragen, die Vielfalt in politischer Praxis, in kulturellen Ausdrucksformen, in Lebensentwürfen und gesellschaftlichen Stilformen. Die elementare Unfähigkeit, die eigene Geschichte zu beleuchten, der Totalausfall einer Reflexion über den Zerfall der Sowjetunion haben ihren Preis. Helmut Ruppel
302 Seiten
15 €

